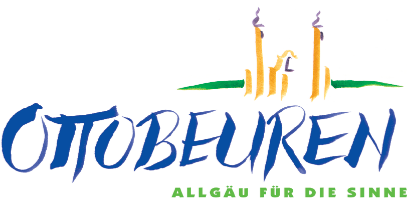24.10.2025 – Vernissage der Ausstellung „Ariadnes Faden“ von Manfred Scharpf
Titel
Beschreibung
Bis 12.04.2026 zeigt das Museum für zeitgenössische Kunst Diether Kunerth im Erdgeschoss die Ausstellung „Ariadnes Faden“ von Manfred Scharpf, während parallel – und bereits seit 29. Mai 2025 – im Obergeschoss Werke der 60er, 70er und 80er Jahre von Diether Kunerth zu sehen sind.
Über die Ausstellungen ist auf der Museums-Homepage zu lesen:
Die ausgestellten Werke von Manfred Scharpf sind gemalte Dokumente aus dem vielfältigen Leben des Malers. In ihm enthalten sind nicht nur die Glücksmomente, sondern auch seine Konflikte mit der Welt, beides ist für ihn von Relevanz für ein erfülltes künstlerisches Leben. Eine Heldenreise zur Erkenntnis. Deshalb fragen wir ihn - was ist sein Fazit aus dieser Reise. Und der Maler antwortet: „Alles was uns widerfährt, ob im Guten oder Schlechten, war und ist unserer Seele innerster Wunsch – ein grenzenloser Raum menschlichen Erlebens.“
Und: In der ersten Ausstellung nach dem Tod von Diether Kunerth (* 10. August 1940 in Freiwaldau, † 11. Dezember 2024 in Ottobeuren) wird eine Auswahl von Werken der 60er, 70er und 80er Jahre gezeigt. Unter anderem sind Werke zu sehen, die von seinen vielen Reisen inspiriert sind. Diether Kunerth sagte immer wieder: „Den Eindrücken, die ich auf meinen vielen Reisen gewonnen habe, verdankt meine Malerei das Meiste.“
In der Biographie von Manfred Scharpf erfahren wir, dass er 1945 in Kißlegg geboren wurde. Er machte eine Ausbildung als Kirchenmaler, mit dem Abschluss der Meisterschule in der Stadt München. Seit 1974 freier Maler mit internationalen Ausstellungen.
Für den Maler Manfred Scharpf schließt sich in Ottobeuren ein Kreis. Hatte doch sein Leben mit der Kunst hier begonnen als Mitarbeiter eines Kirchenmalers. Aus der Kirchenmalerei entwickelte er sein unverwechselbares Werk, unbeeindruckt von den schnell wechselnden Vorgaben der Moderne. Damit hielt er den Ariadnischen Faden in den Händen, der ihn und seine Kunst bis in die Metropolen New York – Sea-Air-Space Museum, Brüssel – EU Parlament, Berlin – Tempelhof und in Paris zur Mona Lisa Alley am Montmartre führen sollte. Er nutzt konsequent die raffinierten historischen Maltechniken, eine Brücke zwischen unserer Herkunft und dem Heute zu schlagen. Seine Materialien sind identisch mit der Malerei des 15. und 16. Jhdts., reichen aber oft bis in die Antike zurück. Deren Weisheit setzt der Maler gegen den Zeitgeist unserer Epoche, lässt Dantes Beatrice, Sybilla, Ariadne, Caecilia und Sophia zu uns sprechen. Für ihn sind sie nichts anderes als Personifizierungen der Anima, der Ursprung schöpferischer Impulse. Es ist gut auf sie zu hören, denn Weisheit ist universell, wie es auch die Konflikte unserer Zeit sind, die wir bewältigen müssen. Auch uns reicht Ariadne den Faden, mit dem sie einst den Theseus aus dem Labyrinth führte.
Die ausgestellten Werke sind gemalte Dokumente aus des Malers vielfältigem Leben. In ihm enthalten sind nicht nur die Glücksmomente, sondern auch seine Konflikte mit der Welt, beides ist für ihn von Relevanz für ein erfülltes künstlerisches Leben. Eine Heldenreise zur Erkenntnis.
Deshalb fragen wir ihn - was ist sein Fazit aus dieser Reise. Und der Maler antwortet: „Alles was uns widerfährt, ob im Guten oder Schlechten, war und ist unserer Seele innerster Wunsch – ein grenzenloser Raum menschlichen Erlebens.“ Den Werken beigefügt sind Anekdoten und schriftliche Notizen, die als Begegnungen, Ideen und Impulse dem Werk vorausgingen und es initiierten. Kunsthistorische Betrachtungsweise ist wichtig, doch reicht sie dem Maler nicht weit genug. Lieber lässt er das Leben und das Erlebte selbst sprechen, als ein Hand-Werker im „Dienste des Geistes“.
Seine Frau, Renata Scharpf Tejová, führte in die Ausstellung ein. Ihr Redebeitrag ist hier abrufbar und erscheint darüber hinaus unten im Textfenster. Die musikalische Umrahmung wurde von Ulrike Meyer übernommen. Das Eingangsbild zeigt Museumsleiter Markus Albrecht und den Künstler Manfred Scharpf vor einem der Hauptwerke.
24.10.2025, Einführungsrede von Renata Scharpf Tejová zur Ausstellung von Manfred Scharpf „Ariadnes Faden“ im „Museum für zeitgenössische Kunst Diether Kunerth“ in Ottobeuren
Sehr geehrte Gäste,
kunsthistorische Betrachtungen sind gut und nützlich, vor allem wenn die Künstler sprachlos sind oder der Vergangenheit angehören. Beides jedoch trifft auf den Maler Manfred Scharpf nicht zu. Und deshalb spreche ich lieber – als seine Frau – über das Leben selbst, aus dem er seine Kunst entwickelte. Nach meiner Erfahrung macht es wenig Sinn, ein Kunstwerk zu analysieren, es ist nicht logisch erklärbar, vielmehr sollte es den Betrachter mit seiner eigenen Stimme informieren. Deshalb geht das, was ich hier spreche, auf die unmittelbaren und authentischen Notizen und Aufzeichnungen des Malers zurück.
Hier, in Ottobeuren schließt sich für den Maler ein Kreis. Ein wichtiger Grund, weshalb er sich freut seine Bilder an diesem Ort zu zeigen. Sein Vater nämlich fuhr mit ihm in den sechziger Jahren nach seiner Malerlehre nach Ottobeuren, um für ihn einen Kirchenmaler zu finden bei dem er die Grundlagen der Malerei erfahren konnte. Eine Gunst der Stunde, denn die Basilika befand sich damals in einer umfassenden Restaurierung und einer der Kirchenmaler nahm ihn in seine Werkstatt auf.
Und tatsächlich – hier begann des Malers Leben mit der Kunst. Nur: Er ahnte damals noch nicht, dass er nicht nur mit den künstlerischen Techniken in Berührung kam, sondern auch ausgezogen war, um das Fürchten zu lernen. Denn gegenständliche Malerei unterlag damals dem Dogma der Moderne und einem strikten Tabu. Künstlerische Freiheit erlebte er als eine Farce. Und dennoch, er wurde beschenkt mit einem Leben in allen Schattierungen von Hell und Dunkel in unerhörter Farbigkeit, wie es schon als Kind sein innerster Wunsch war. Seine Bilderreise mit dem Motto „Ariadnes Faden“ spiegelt dies wider. Dass sie vorzugsweise Frauenportraits beinhaltet, sollte uns nicht vom tieferen Gehalt ablenken, so schön sie auch sind. Denn sie repräsentieren lediglich das Prinzip der Anima als schöpferische Kraft, eine Metapher für die Kunst.
Für den Maler sind Fragen die Frömmigkeit des Denkens. Doch wie er stellen auch wir sie uns immer wieder:
Was haben wir vergessen?
Wir haben vergessen wer wir sind, wir haben vergessen was wir sind, wir haben das tiefe Sehen vergessen, wir haben unsere Empfindsamkeit verloren.
Wo befindet sich der Faden Ariadnes, den wir verloren haben und an dem wir uns wieder orientieren könnten?
Des Malers Antwort ist kurz. Die Wahrheit liegt in uns allen, jedoch verborgen und verschüttet. Doch können wir sie freilegen und ergreifen. Denn die schöpferische Kraft der Anima (oder Ariadne) geleitet nicht nur den Künstler, sondern uns alle wenn wir auf Inspektionsreise mit uns selbst gehen.
Obwohl es sicher die heimliche Absicht seiner kunstverständigen Eltern war, ihren Sohn eines Tages auf Grund seines Talents Künstler werden zu lassen, hatte sich der Knabe bereits vorher mit Leib und Seele den Techniken der Malerei zugewandt. Und bis heute sind die Traktate Leonardos eine Richtschnur, als ein Handwerker im Dienste des Geistes zu stehen. Zufällig oder nicht, richtete er sein Atelier – oder besser seine „kulturelle Werkstatt“ vor 35 Jahren in der Alten Schule von Schloss Zeil ein. Seit dieser Zeit arbeitet er mit dem Anspruch, die historischen Malmittel und Techniken nicht gegen Neuzeitliche einzutauschen. In jüngster Zeit sogar gab er ein Malerbuch heraus, das alle alten Verfahren die er nutzt offenlegt und Anderen zur Verfügung stellt. Eine Renaissance des Natürlichen und Echten.
In seiner engeren Heimat galt der Maler als widerspenstig oder sogar „unbotmäßig“. Aber ganz im Stillen entwickelte er damals aus der Kirchenmalerei seine für viele solitäre Kunst, die dann durch die Qualität seiner Arbeiten zu außerordentlichen internationalen Ausstellungen in New York - Sea- Air- and Space Museum Intrepid, in Brüssel im Parlament der EU, in Berlin Tempelhof und im vergangenen Jahr zur „Mona Lisa Alley“ in Paris führte, um nur einige zu nennen. Ein Sonderfall in der Kunst, weil sie zum einen Teil auf dem sicheren Boden eines Handwerks entstanden war und andererseits aus den Erfahrungen resultierte, die der Maler auf seiner Lebensreise erwarb. Schon in den 70er Jahren schrieb der Regisseur des BR Gerhard Ledebur: „Es sind Bilder, die viel vom Lebensgefühl unserer Zeit wiedergeben und es freut mich, dass sich ein Talent auch ohne den Hokuspokus des Kulturbetriebs durchsetzen kann.“ Vom Leiter des Auktionshauses Sotheby’s in München stammten die Worte: „In einer Zeit, wo so viel von dem, was wir erleben und unter Kunst zu sehen und zu verstehen bekommen, weg von der Natur und weg vom Gegenständlichen führt, war es für mich eine Augenweide, die Gemälde von Manfred Scharpf gezeigt zu bekommen.“
Das Labyrinth des Lebens
Der hier gezeigte Bilderzyklus des Malers unter dem Motto „Ariadnes Faden“ stellt auch die Frage nach unserer Sicht der Welt und unserem Sinn in ihr. Ist sie gut oder ist sie schlecht, ist sie geschlossen oder ist sie offen? Ist sie endlich oder ist sie unendlich? Reicht unser Blick über persönliche Erfahrungen hinaus? Akzeptieren wir das Andere außerhalb unseres Radius Stehende? Gehen wir den richtigen Weg? Nach achtzig Jahren der Welterfahrung ist der Maler der Überzeugung, dass alles, was aus uns wird – im Guten oder im Schlechten, nichts anderes war und ist als der innerste Wunsch unserer unsterblichen Seele. Damit befindet er sich in der Nähe der Psychoanalyse von Freud und Jung, der Neurologie, aber auch nahe der Quantentheorie und „Schrödingers Katze“.
Was verbindet diese so unterschiedlich wie vielschichtigen Arbeiten des Malers? Was bildet den Zusammenhang, wo ist der rote Faden der durch das Labyrinth derart komplexer Ideen, Motiven und Techniken führt? Die Erklärung finden wir in des Malers ursächlicher Intention und Biografie. Es ist die Neugier, die Welt zu begreifen – und diese Neugier ist das eigentliche Band, das ihm Ariadne reichte, die Anima des schöpferischen Geistes, die ihn lenkte und führte, die ihn unbeschadet auch durch Abgründe leitete. Es ist eine Durchwanderung des physischen wie geistig-seelischen Raumes, mehrdimensional, von unerhörter Vielfalt und Farbigkeit. In seinem Werk bündelt der Maler diese Erfahrungen mit der Welt und verleiht ihnen gemalte Form.
Manfred Scharpf kennt keinerlei Berührungsängste. Er ist nicht nur ein Meister der Malerei, sondern auch der Lebenskompetenz. Und wenn er auch manchmal den Faden verlor, so erhaschte er ihn mit ruhiger Gebärde nach kurzer Zeit wieder. Die Welt zu verstehen heißt für ihn, sich in gegensätzlichen Erlebnisbereichen zu bewegen, sie zu betrachten und sie zu studieren. So stammt sein Modell des Mona Lisa Zyklus nicht aus dem Louvre, sondern aus dem Rotlichtmilieu von Brünn. Andere Themen aus der Naturwissenschaft, der Psychologie oder aus dem christlich-abendländischen Kontext. Sein größtes Werk „Beatrice - der Weg aus dem Dunkel“ entstand im Salvatorkolleg in Bad Wurzach als lebendiger Kunstunterricht für eine Gruppe von Schülern. Gerade dieses Werk ist ein treffendes Beispiel für die Fallen in der allgemeinen Wahrnehmung. Es geht nämlich nicht um das vorgeprägte Bild einer Pieta, sondern um menschliche Wärme und Zuwendung als Basis eines erfüllten Lebens. Beatrice fängt uns auf, wie sie einst den Dante rettete. Alternativ dazu der Verlust von Empathie und Mitgefühl, die Konsequenzen und Auswüchse daraus, sind auf den Seitenflügeln zu sehen. Dasselbe Programm in der Schilderung finden wir in der archaischen Kybele, doch ist es hier nicht Dante, sondern die Gestalt des Narziss, dessen Sturz nach mancherlei Höhenflügen von vornherein feststand.
An diesem Punkt noch einmal die Frage: Was haben wir vergessen? Wir haben die Grundierung unserer Existenz und Kultur in Form unserer Geschichte vergessen. Wir haben uns verloren im Wahn des alles Machbaren durch Technik und Konsum. Wir haben vergessen, wer wir sind und stellen die Frage, was von uns bleibt.
Wer ist dieser Maler, der solche Fragen stellt? Er ist Christ, sagt er lapidar, er liebt die platonsche Trias vom „Wahren, Guten und Schönen“, die uns retten könnte aus den Verzerrungen des oben Gesagten. Er ist Maler und kein Färber. Oft wird es ihm zu bunt, deshalb überlässt er Interieur, Kunst und Bildtapeten anderen. Seine Malmittel entsprechen den höchsten Ansprüchen, er ist ein Gourmet wertvoller Farben wie eines genussvollen Lebensstils. Seine gemalten und teilweise verstörenden Ahnungen erfüllen sich leider nur zu oft. Und eben diesen begegnet er mit der Platonschen Trias. Oft wurde er als „malender Prophet“ beschrieben, jedoch reagiert er daraufhin im besten Fall mit mildem Lächeln.
Bei vielen seiner Gestalten greift er auf die Mythen zurück, mit ihren ewig gültigen Wahrheiten. Er läßt Kybele und Narziss, Parcival, Cäcilia, Sybilla und Magdalena zu uns sprechen. Und nun Ariadne. Ihre über Jahrhunderte gültigen Weisheiten setzt er mit kostbarsten Materialien, die für ihn heilige Substanzen sind, in Bilder um, die vom heutigen Menschen gelesen und betrachtet werden können. Und vielleicht sogar – wer weiß – auch verstanden.
WEIHRAUCHS BÖSE BILDER
2009 kam er auf den Punkt. Nach seinen Motiven der Alchemie, der Heilräume, von Leidenschaft und Heldentum und der Magna Mater fasste er Goethes Faust in einen Bilderzyklus.
„Ich bin nur durch die Welt gerannt,
ein jed wed Gelüst ergriff ich bei den Haaren
was nicht genügte, ließ ich fahren,
was mir entwischte, ließ ich ziehen,
ich habe nur begehrt und so mit Macht..."
Auch er, ein malender „Faust“ versuchte lange Zeit sich die Welt unersättlich einzuverleiben.
Wie Narziss wünschte er sie allein zu seinem Genuss zu besitzen. Unaufhaltsam trieb ihn eine geheime Kraft weiter durch düstere und helle Korridore des Lebenslabyrinths, durch abgründige Tabuzonen und als Gourmet zu den Köstlichkeiten der Welt. Und dann regte sich in ihm ein Verdacht. Er fühlte, alles war in ihm selbst, auch der Minotaurus, der in ihm wirkte und ihn manipulierte, den er zu besiegen hatte, bevor er weiterging. Aber anders als den Helden Theseus geleitete ihn Ariadnes Faden nicht zum horizontalen Ausgang des Labyrinths, vor dem nämlich schon das Nächste wartete, sondern in jeden Winkel der Räume und Kammern, die meisten ihm fremd geblieben, dicht gepackt mit seinen eigenen zwanghaften Vorstellungen. So schön manche, so hässlich andere, aber selbst diese nahm er als Materia Prima, als Werkstoff, aus dem schließlich gemalte Bilder entstanden. Im Zuge seiner Wanderung erfuhr er schließlich, dass es nicht in seinem Wesen lag, dem Labyrinth zu entkommen, sondern seine Geheimnisse zu entdecken. Er erreichte den Punkt, der schon immer vor ihm lag, doch seinen Augen verborgen, an dem ihn Ariadne erwartete, schöner als je zuvor. Sie lenkte den Blick des Malers über die Mauern des Labyrinths, das er nun von oben in vollkommener Klarheit und Komplexität erkennen konnte. Doch sie lenkte ihn zurück zu sich und bot ihm – dem Maler – den Kuss mit der Göttin und Muse.
Eintrag in sein Tagebuch:
„Pictor sah einen Garten mit Pflanzen, lachende Fluren mit schönen Menschen. Eine in sich geschlossene und doch wunderliche Unendlichkeit wie der Garten der Villa Cimbrone von Ravello. Aber er sah auch den trüben und verstellten Blick der von Feindschaft zerfressenen Menschen, die die Empfindung für das Wahre, Schöne und das Gute verloren hatten.
Es war die stumpfe Angst vor dem Verlust des Erworbenen und oberflächlichen Genusses, der schon längst trivial und schal geworden war. Er sah feuerspeiende Waffen, stürmisch bewegte Aggression, aber er sah auch die Göttin Ceres in ihrem Tempel, und die Nymphe Egeria, den Fuß tief im Wasser des Lebens und der Weisheit. Ganz weit hinten erblickte er den Kompost, der aus dem Vergehen einstigen Lebens entstand und nun in diesem Garten den Rosen ihre Farben verlieh.
Und dann, unmittelbar neben ihm, regte sich plötzlich eine zottige Gestalt und erhob sich. Es war der Minotaurus, den er – wie auch Theseus – glaubte, vor langer Zeit besiegt zu haben.
Pictor erschrak und begriff in einem Augenblick, Schönheit und Schrecken waren ein und derselbe Teil des Labyrinths, gehörten zusammen wie Licht und Schatten.
Und nun bewacht der stierköpfige Minotaurus des Malers achtes Lebensjahrzehnt in seinem zum Atelier verwandelten Irrgarten. Nur morgen – und übermorgen wieder, wenn Pictor zaudert oder in Angst verfällt, wenn er schwankt oder sich schwenken, sich beugt oder sich beugen lässt, erwacht mit Knurren und funkelnden Augen das urtümliche Wesen. Pictor erlebt einmal mehr seine Metamorphose: Aus dem strähnigen Pelz der Kreatur wachsen die seidenweichen Haare seines Pinsels, dessen rotlackierter Stiel sie fasst und ihnen Rückgrat verleiht. Im gleichen Augenblick erscheint Ariadne und krönt mit goldenem Band die gehörnte Stirn des Fabelwesens, das niemand anders ist und immer war, als er, Pictor selbst.
Wie begegnet Ariadne uns, den Anderen fragen wir? Betroffen stehen wir in einem Raum und einer Zeit, die keine festen Begrenzungen mehr zu haben scheinen. Wie begegnen wir dem Leben?
Wer reicht uns den Faden mit den daran aufgereihten schwarzen, roten und schillernden Perlen? Vielleicht die Kunst oder die Philosophie?
Dazu noch ein Wort:
Mag der Maler noch so viele Hautschichten in noch so perfektem Sfumato übereinanderlegen, im Wechsel von kalt und warm, von hell und dunkel, der Funke des tatsächlichen Lebens hält sich zurück. Das Werk verlangt mehr, es verlangt den Dialog mit dem äußeren Betrachter, dessen Geist sich dem des Künstlers annähert. Ergreifen Sie also den Faden oder das Band und treten Sie mit offenem Geist und offenem Herzen vor die Bilder, erwecken Sie diese zum Leben und eröffnen Sie den Dialog mit ihnen.
Lassen Sie sich in die Hintergründe der Themen und Motive führen, in die Tiefe hinter schönem Schein. Aber auch das Schöne hinter den Abgründen will entdeckt werden. Ariadnes Faden unterstützt uns dabei, einen Blick über das Gewohnte hinaus zu werfen.
Ich danke Ihnen für das Zuhören.
________________________________
Zum ersten Mal war Manfred Scharpf im Juli 2013 mit einer Ausstellung in Ottobeuren: im Haus des Gastes im Rahmen der Ottobeurer Konzerte.
Zusammenstellung und Repros: Helmut Scharpf, 10/2025