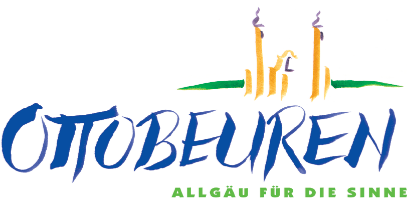31.03.1915 – Die letzte Postkutsche fährt aus Ottobeuren aus
Titel
Beschreibung
Josef Hasel, der spätere Bürgermeister Ottobeurens, war zu richtigen Zeit am richtigen Ort (hier: in Kuttern) und hatte noch dazu – als schon in jungen Jahren begeisterter Fotograf – eine Kamera dabei, um die Szene festzuhalten: Eine Ära ging zu Ende, die letzte Postkutsche hat am 31. März 1915 Ottobeuren auf dem Weg nach Obergünzburg (bzw. Günzach) verlassen. Wenn auch nicht ganz freiwillig!
In seinen Memoiren geht Hasel kurz auf das Ereignis ein:
„1915 war die letzte Postkutschenfahrt und der Zufall: In Kuttern habe ich diese fotografieren können. Nachbar Petrich Hans als Gast, Rothärmel in großer Uniform als Postillion.“
[Der Sattler Hans Petrich hatte seinen Betrieb in der Luitpoldstraße 2, in 2025: Café Galerie.]
Das Ottobeurer Tagblatt vom 17. April 1915, S. 4 („Lokales“) berichtete nur einmal davon:
Postomnibusfahrten.
Der Poststallhalter in Ottobeuren hat erklärt, die täglich einmaligen Postomnibusfahrten zwischen Ottobeuren und Obergünzburg mit der durch Bundesratsverordnung vom 13. Februar zugewiesenen geringen Hafermenge nicht ausführen zu können. In Anbetracht dieser Verhältnisse, sowie im Hinblick auf den äußerst geringen Postsachen- und Personenverkehr wurde die Teilstrecke Ottobeuren - Hopferbach seit 1. April aufgehoben.
Die Hintergründe der Einstellung der Linie gehen demnach: zu wenig Fahrgäste und gleichzeitig – kriegsbedingt – zu wenig Hafer, um die Pferde ausreichend zu versorgen. Die Rationierung des Futters war kurz zuvor angekündigt worden:
Ottobeurer Tagblatt vom 17.03.1915, S. 2
Haferverbrauch.
Amtlich wird mitgeteilt: Wiederholte Klagen und Mitteilungen lassen ersehen, daß viele Pferdebesitzer bei Verfütterung ihrer Hafervorräte noch in sorgloser Weise vorgehen und nicht entsprechend berücksichtigen, daß ihnen pro Pferd bis zur nächsten Ernte nur eine Gesamthaferration von 300 Klgr. zur Verfügung steht. Es besteht daher Veranlassung, die Pferdebesitzer wiederholt darauf hinzuweisen, daß mit einer Erhöhung dieser Ration für Privatpferde nicht gerechnet werden kann und daß es unter allen Umständen gilt, mit diesem Haferquantum auszukommen.
Ein gewisser Ausgleich könnte nur innerhalb des einzelnen Kommunalverbandes dadurch getroffen werden, daß die Ration für leichte Pferde noch mehr heruntergesetzt und aus der so eingesparten Menge die Ration für schwere Pferde erhöht wird. Allein viel ist davon nicht zu hoffen, da die Kommunalverbände sich schwer entschließen werden, die Rationen für die Mehrzahl der Pferde noch weiter zu beschränken. Die Zentralstelle zur Beschaffung der Heeresverpflegung ist nicht in der Lage, für die Pferde von Privaten größere Hafermengen, als sie nach der Verordnung vom 13. Februar laufenden Jahres den Pferdebesitzern vorbehalten sind, zuzuweisen. Nach den Beratungen des Senates der Zentralstelle sind Erhöhungen auf ein Minimum zu beschränken und von vornherein ausgeschlossen, soweit es sich nicht um Gestütspferde, angekörte Hengste und Bergwerkspferde handelt.
Irgendwelche Gesuche von Besitzern anderer Pferde haben keinerlei Aussicht auf Berücksichtigung. Auch Brauereien, Poststallpferde, Schutzmannspferde, Rennpferde usw., sind auf die tägliche Ration von drei Pfund Hafer beschränkt und erhalten von der Zentralstelle keine Zulage. —
Es kann daher den Pferdebesitzern nicht eindringlich genug nahe gelegt werden, sich streng an die durchschnittliche Futterration von drei Pfund Hafer für den Tag zu halten, da bei Enteignung der Hafervorräte irgend welche Rücksicht auf den in der Zwischenzeit entgegen den Vorschriften erfolgten Mehrverbrauch nicht genommen werden kann und die Pferdebesitzer es sich dann selbst zuzuschreiben haben, wenn sie bis zur nächsten Ernte vollkommen ohne Hafer auskommen müssen. Auch die Kommunalverbände haben das dringendste Interesse, den Verbrauch des Hafers genau zu überwachen, da ihnen jeder unzulässige Mehrverbrauch bei der seinerzeitigen Zuweisung ihres Bedarfsanteiles durch die Zentralstelle zur Beschaffung der Heeresverpflegung abgezogen wird.
___________________________
In Richtung Memmingen war der Linienverkehr mit Kutschen durch die Eröffnung der Lokalbahnlinie (Memmingen - Ungerhausen - Westerheim -Hawangen - Ottobeuren) bereits im Oktober 1900 eingestellt worden.
Über die Geschichte der Posthalterei in Ottobeuren – und damit verbunden auch die Personenbeförderung – gibt die Sonderausgabe des Ottobeurer Volksblatts Auskunft, die Anfang 1922 erschien. Hier die Abschrift des lesenswerten Artikels:
Heimatblatt (1922), Kapitel „Verkehrswesen in Ottobeuren“
Ohne unser heutiges Postwesen, ohne Telegraph, ohne Telephon, ohne Eisenbahn, Automobil usw. können wir uns die Möglichkeit eines Verkehrs fast nicht mehr vorstellen. Und doch sind diese Einrichtungen alle eigentlich erst jüngsten Datums und haben unsere Großväter hier in Ottobeuren von all dem noch nichts besessen. Gleichwohl sind auch sie in der Welt herum gekommen und sind in regem Verkehr mit derselben gestanden. Aller Verkehr wickelte sich zu Fuß oder zu Wagen ab. Wanderungen von 5 - 6 Stunden, ob deren man heute fast angestaunt wird, waren unsern Altfordern ganz geläufig. Denken wir nur zum Beispiel an die vielen Wallfahrer, die hieher nach Eldern kamen aus dem Allgäu und darüber hinaus. Man marschierte 8 - 9 Stunden und mehr, übernachtete hier, verrichtete seine Andacht und seine Geschäfte und ging frohen Mutes wiederum den gleichen Weg zurück, um dann daheim viel von dem Erlebten und Geschauten zu erzählen. Noch lange zehrte man von den Freuden der Reise.
Der Fernverkehr geschah dann durch Lohnkutscher und fahrende Posten. Eine solche „kaiserliche Reichspostamtsexpedition fahrender Posten“ war auch in Memmingen. Wie die meisten Klöster in den nächstgelegenen Städten hatte das Kloster Ottobeuren in Memmingen ein Haus, um raschestens jede Post oder Botengelegenheit benutzen zu können. Durch den Boten zwischen dem Kloster und seinem Haus in Memmingen wurde wohl auch die Post für den Ort besorgt. Einen Anhalt über die damaligen Postgebühren gibt ein mir vorliegender Einlieferungsschein der kaiserl. Reichspostamtsexpedition fahrender Posten in Memmingen für ein Paket an den Agenten des Klosters Ottobeuren am kaiserlichen Hof in Wien. Die Beförderung kostete damals 1 fl. 38 kr. [1 Gulden, 28 Kreuzer] — (Vor ein paar Tagen habe ich ein Buch aus Wien erhalten. Marken im Werte von 180 Kronen waren dieser Drucksache aufgeklebt.) —
Einen bedeutenden Aufschwung nahm das Verkehrswesen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ein „Verzeichnis der Brief- und Fahr-Post-Kurse zu Memmingen“ aus dem Jahr 1842 enthält bereits folgende Briefposten: a) täglich: Nach Mindelheim, Türkheim, Schwabmünchen, Augsburg. Nach Kempten, Kaufbeuren, Augsburg und München. Nach Leutkirch, Wangen, Lindau, Schweiz, Vorarlberg, Mailand. Nach und über das Tirol. Ferner b) Montag und Freitag nach Krumbach, Dienstag und Mittwoch und Freitag nach Ochsenhausen und Biberach. Samstag nach Biberach allein. Montag, Mittwoch und Freitag nach Wurzach, Wolfegg, Ravensburg, Meersburg, Konstanz. Stockach, Schaffhausen, Basel. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag nach Illertissen, Ulm, Stuttgart. Donnerstag, Samstag, Sonntag indirekt nach Ulm. Fahrposten hatte Memmingen folgende: Täglich ein Eilwagen von Augsburg über Memmingen nach Lindau und zurück. Einmal wöchentlich Biberach, Memmingen und zurück. Kempten - Ulm über Memmingen und zurück. Memmingen, Wurzach, Wolfegg, Ravensburg, Meersburg, Konstanz.
1843 fuhr täglich eine Eilpost zwischen Memmingen und Füssen. Die Schnelligkeit des damaligen Reisens mag uns eine Fahrt veranschaulichen, die ein paar hiesige Bürger als Abgesandte der Gemeinde zu einer Audienz beim König in Aschaffenburg machten. Nach den noch vorhandenen Reisescheinen stiegen sie am 20. Mai in Ottobeuren ein. Der Lammwirt fuhr sie um 12 fl. bis Augsburg. Am 23. Mai waren sie in Aschaffenburg angelangt.
Eine Fahrt im Eilwagen von Erkheim nach Augsburg kostete 4 fl. 56 kr. (9 Mark). Daß Ottobeuren, das ja mit Memmingen gleichen Schritt halten wollte, gar bald ebenfalls um eine Postanstalt eingab, ist selbstverständlich. Hatte doch bereits Abt Honorat [Göhl] Ottobeuren mit allen umliegenden größeren Orten durch ein großes teilweise unter seiner Regierung angelegtes Straßennetz in Verbindung bringen wollen, so mit Memmingen, Mindelheim, Kaufbeuren, Obergünzburg, Kempten. 1840 wurde eine Eingabe gemacht. Aber die Sache zog sich sehr in die Länge. Erst 1846 erhielt Ottobeuren einen täglichen Postboten nach Erkheim zum Postwagen. Am 12. Oktober 1847 wurde dann die Errichtung einer Brief- und Fahrpost-Expedition mit Poststall genehmigt und zur Bewerbung im Ottobeurer Wochenblatt ausgeschrieben. Bedingung war Besitz eines eigenen Hauses, das an der Straße gelegen für die Anfahrt vom Wege kein Hindernis darbietet und mit den erforderlichen Gelassen für den Dienst und die Reisenden versehen ist. Der Adlerwirt (heutige Post) und Baumeister Anton Billmann bewarb sich um die Expedition und erhielt sie. Die Entwicklung dieser Verkehrsanstalt soll nun geschildert werden.
Mit dem 1. Januar 1848 trat die Postanstalt Ottobeuren ins Leben. Es fuhr zunächst eine Carriolpost zwischen Memmingen und Ottobeuren, dazu kam noch eine Reitpost zwischen Ottobeuren und Obergünzburg. Letztere war nur zur Beförderung der Briefpostsendungen bestimmt. 4:30 nachmittags fuhr die Post in Memmingen ab und kam 5:50 in Ottobeuren an. 9:20 nachts ritt dann der Postillion nach Obergünzburg weiter, wo er nachts 11 Uhr zum Anschluß an den ersten Eilwagen nach Kaufbeuren (Augsburg – München) anlangte. Früh 2 Uhr nach Ankunft des ersten Eilwagens von Kaufbeuren ritt er wieder nach Ottobeuren zurück bis 4 Uhr morgens. 6 Uhr morgens bis 7:20 fuhr dann der Wagen wieder von Ottobeuren nach Memmingen. Personen beförderte die Carriolpost nach Memmingen übrigens erst im Jahre 1853. Man mußte sich abends zuvor anmelden. Im Herbst verkehrte auch ein Postomnibus Ottobeuren – Günzach.
1852 trat Billmann als Postexpeditor zurück. Es bewarben sich der Lammwirt Joses Kichler (Hausnr. 2) und der Nachfolger des Adlerwirtes, Max Wittwer. Letzterer, der schon auswärts eine Expedition versehen hatte, siegte. Aus dem Übergabedekret sehen wir die damalige Ausrüstung der Postanstalt.
Als Personal war erfordert ein Expeditor und ein Wächter. Die Ausrüstung bestand in 3 diensttauglichen Pferden, einer viersitzigen Chaise, gedeckt und verschließbar, einem Felleisenkarren, einer Estafettentasche. Die Besoldung des Expeditors bestand in einem festen Gehalt von 190 fl. und 5 Prozent der anfallenden Gebühren. Davon mußte er aber auch die ganze Postausrüstung bestreiten. Der Anteil an den Gebühren mag nicht besonders groß gewesen sein, denn die damaligen Postgebühren waren gering. Ein Einlieferungsschein für ein Paket aus dem Jahre 1853 von Wittwer unterzeichnet sagt uns, daß Beförderung desselben von hier nach Immenstadt nur 7 kr. (22 Pfg.) kostet (heute 20 Mark).
Den damaligen Umfang des Postbezirkes können wir aus einer Dienstvorschrift für den Postboten aus dem Jahre 1860 erfahren. Darnach hatte der Postbote täglich folgenden Gang zu machen: Dennenberg – Altisried – Gottenau – Rettenbach – Engetried – Betzisried – Guggenberg – Ottobeuren – Hawangen – Lachen – Albishofen – Goßmannshofen – Ottobeuren. Den Namen des wackeren Boten, der dies täglich leistete, kennen wir leider nicht mehr. Übrigens wurde der Weg bald auf zwei Tage verteilt, wobei allerdings Frechenrieden – Lannenberg – Linden – Oberhaslach – Ollarzried – Dingisweiler noch einbezogen wurden.
Eine Erweiterung des Postbetriebes brachte das Jahr 1856. In diesem Jahre wurde die Bahn Augsburg – München – Lindau eröffnet [Eröffnung des letzten Abschnitt am 1. März 1854]. Natürlich suchte man möglichsten Anschluß an diese Bahn, die täglich 4 mal hin und zurück fuhr, nämlich zwei Güterzüge, ein Eil- und ein Postzug. Ein Postomnibus von Memmingen über Ottobeuren und Obergünzburg nach Günzach vermittelte diesen Anschluß. Er verkehrte täglich einmal. Die Fahrtaxe von Ottobeuren nach Günzach betrug 57 fr. (1,75 Mk.) Ein Billet 3. Klasse von dort nach München 2 fl. 36 kr. (4,50 Mk.).
Bald ward eine neue Bahnlinie in Aussicht genommen, eine Verbindung zwischen den Linien München – Lindau und München – Ulm. Die Bahn sollte von Ulm über Memmingen geführt werden und von dort über Ottobeuren nach Günzach oder über Grönenbach nach Kempten. Das Ottobeurer Projekt unterlag. Ein anderes Eisenbahnprojekt 1866 kam hauptsächlich durch die Bemühungen einiger Ottobeurer Geschäftsleute, die einen Entgang fürchteten, nicht zustande.
Die Bahn Ulm – Kempten hatte für den Postverkehr die Wirkung, daß bald täglich 2 Fahrten zwischen Ottobeuren und Memmingen stattfanden und gelegentlich auch nach Grönenbach.
Als dann die 3. Bahn Buchloe – Memmingen 1874 in Betrieb genommen wurde, suchte man um eine Postverbindung nach Sontheim und um eine Telegraphen-Station nach. Erstere wurde sogleich gewährt, aber bereits im folgenden Jahre wegen Mangel an Fahrgästen wieder eingestellt. Die Telegraphenstation wurde 1877 errichtet. 1880 starb der Postexpeditor und ging die Expedition auf seinen Sohn über. Bei Gelegenheit dieser Übergabe erfahren wir, daß in diesem Jahre 2185 Personen nach Memmingen befördert wurden, wofür 2114,30 Mark eingingen. 1889 wurde noch eine dritte tägliche Fahrt nach Memmingen hin und zurück eingefügt.
Nachdem 1893 Wittwer kündigte, erfolgte eine Trennung der Postexpedition und des Poststalles. Letzterer verlor immer mehr seine Bedeutung, indem am 22. Oktober 1900 am Tage der Eröffnung der Lokal-Bahn die Fahrten Ottobeuren – Memmingen eingestellt wurden. Am 31. März 1915 sind dann auch die Postfahrten Ottobeuren – Günzach eingegangen. Wiederaufgelebt ist der Poststall am 1. April 1920 für die tägliche zweimalige, jetzt dreimalige, Abholung der Bahnpost.
Die Trennung der Expedition vom Poststall machte auch eine Verlegung des Postlokales notwendig. Die Expedition, die Leopold Schlicht mit einem Gesamtbezug von 2448 Mark übernommen hatte, wurde in dem Haus Nr. 120 [in 2025: Konditorei Gerle] untergebracht.
Ein Ereignis für Ottobeuren bedeutete die Anbringung zweier Briefkästen am Haus des damaligen Bürgermeisters Kimmerle (jetzt Darlehenskasse Ottobeuren) und beim Buchdrucker. Sie wurden zweimal entleert. Ihre Zahl stieg bis 1900 auf 5 mit täglich fünfmaliger Entleerung, seit 1911 sind es 10 Briefkästen.
Diese Steigerung des Postverkehrs und namentlich die Errichtung einer Telephonsprechstelle im Jahre 1900 bedingte wiederum einen Umbau und eine Erweiterung des Postlokales und Schaffung eines eigenen Schalterraumes im Jahre 1902. Dies war bereits die Tat unseres jetzigen Herrn Postmeisters Wachter, der 1901 die Poststelle übernommen hatte und auch 1911 mit in unser jetziges schönes Postlokal am Marktplatz [in 2025. Beck’sche Apotheke] übersiedelte.
Interessant ist es noch an Hand einer kleinen Zahlenzusammenstellung die allmählige Steigerung des Verkehrsumfanges zu beobachten. Die an sich trockenen Zahlen erzählen zugleich auch von der Arbeit unseres heutigen Postpersonals, das sich zusammensetzt aus 1 Postmeister, 2 Sekretären und 6 Postschaffnern.
___________________________________
Das Gebäude, an dem die Aufnahme im Böhener Ortsteil Kuttern (in Richtung Waldmühle) entstand, steht übrigens heute noch. Eine Aufnahme vom 19.05.2024 zeigt die ehemalige „Maschinen-Reperaturwerkstätte“ von Schmiedmeister Josef Maugg; die Straße in Richtung Böhen verlief 1915 offensichtlich unmittelbar südlich am Gebäude vorbei.
Literaturtipp:
1996 hat Kurt Ebenhoch ein Buch zur lokalen Postgeschichte herausgegeben („Die Postgeschichte von Memmingen“); im Stadtarchiv Memmingen ist es in der Freihandbibliothek verfügbar.