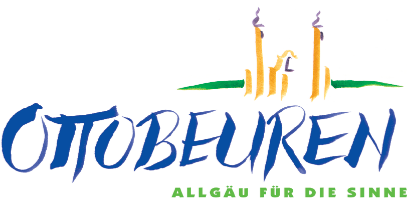26.08.1925 – Fischertag Memmingen mit historischem Festzug
Titel
26.08.1925 – Fischertag Memmingen mit historischem Festzug
Beschreibung
Zwischen Ottobeuren und Memmingen verkehrten – anders als von vielen weiteren Orten aus – zum Fischertag am 26. August 1925 zwar keine Sonderzüge, beim Gemeindediener Wölfle konnte man aber auch in Ottobeuren für eine Mark Festzeichen kaufen.
Laut der damals aktuellen Volkszählung wohnten in Memmingen 14.111 Personen, 14% mehr als noch 1910. Auch die Zahl der Haushalte – 1910 waren es 2.994, 1925 dann mit 3.626 sogar 21% mehr – war deutlich gestiegen. Die Bedeutung des Fischertags kann man insofern auch an der Zahl der Besucher ermessen, denn es kamen mit 20.000 mehr als Memmingen damals Einwohner hatte! Der Vollständigkeit halber hier die Zusammensetzung der Memminger Bevölkerung nach Konfessionen: 6.595 waren evangelisch-lutherisch, 24 sonstige Protestanten, 7.166 waren römisch-katholisch, 195 Israeliten und 131 Sonstige.
Im Zusammenhang mit Wallensteins Einzug in Memmingen zeigt das Foto – im wahrsten Sinne des Wortes – eine „Schlüsselszene“, denn Wallenstein (hier gespielt von W. Göppel) lässt sich vor der Großzunft vom Bürgermeister symbolisch den Schlüssel der Stadt übergeben. An den Gebäuden dazwischen lässt sich ablesen: Schuhhaus Josef Kraus bzw. Schnellsohlerei von Josef Kraus / Uhrengeschäft Maria Mühleisen. Das Ottobeurer Tagblatt (gleichzeitig Memminger Volksblatt und Schwäbischer Generalanzeiger Babenhausen) berichtete sehr ausführlich, am 24.08.1925 verwandelte sich die Zeitung sogar in eine mehrseitige Fischertags-Festzeitung.
Nachfolgend sei hier die Abschrift einiger Artikel wiedergegeben, vom 03.07. bis 31.08.1925:
Ottobeurer Tagblatt, 03.07.1925, S. 3:
Großer Fischertag.
Der Festplatz an der Grimmelschanz gesichert.
Die Werbeplakate von Willi Schropp sind eingetroffen.
Zum großen Fischertag in Memmingen am 25 /26. August wird seitens der Ausschüsse vorbildlich gearbeitet, um das Fest zu einem wirklichen Volksfest zu machen. Gestern tagte im „Waldhorn“ der „Presse- und Werbungsausschuß“, in dem vor allem bekanntgegeben wurde, daß der Festplatz an der Grimmelschanze nunmehr durch großes Entgegenkommen der Frau von Wachter und des Pächters Hrn. Huber zum „Strauß“ gesichert ist. Die ganze, sogenannte Grimmelschanz, die sich vom Burgsaal bis zum Bürger- und Engelbräu westlich an die Stadtmauer anlehnt, ist Festplatz.
Hier, auf dem 3 Tagwerk großen Platz unter dem Schutze des 1445 erbauten, mit seinen Schwalbenschwanzzinnen trotzig in die Welt schauenden Mehlsackturmes findet auch die Krönung des Fischerkönigs mit altem Drum und dran statt.
Der Bierausschank erfolgt in zwei großen Bierzelten, die vom Bürger- und Engelbräu und von der Schiffbrauerei erstellt werden. Außerdem sind auf dem Festplatz 3 Wurstbuden, 2 Bäckerbuden, 2 Konditorbuden, 2 Buden für Rauchwaren und Liköre, eine Weinbude, 2 Limonadenbuden und eine Käsebude. Der Fischertagsverein wird die hiesigen Geschäftsleute in nächster Zeit zur Beteiligung einladen.
Als Militärmusik
wurde die vollzählige, 33 Mann starke Kapelle des 5. Pionier-Bataillons Ulm unter der Leitung des Obermusikmeisters Wolter verpflichtet. (…)
Nr. 185, Freitag, 14.08.1925, S. 9
Vom Fischertag. Seit dem Kriege soll heuer zum ersten Male wieder der Memminger Fischertag in seiner alten Pracht und Größe gefeiert werden. Die Festlichkeiten erstrecken sich über den 25. und 26. August. Am 25. August, dem Vorabend des eigentlichen Festes, findet abends 8 Uhr in den Zelten auf dem Festplatz der Begrüßungsabend mit Vorführungen statt.
Am 26. August früh halb 8 Uhr ziehen die kostümierten Fischer in die Stadt, um 8 Uhr beginnt das Ausfischen des Stadtbaches, woran sich um 10 Uhr der Frühschoppen auf dem Festplatz anschließt. Während desselben erfolgt die Krönung des Fischerkönigs und die altherkömmliche Auslosung der Forellen. Nachmittags um 2 Uhr beginnt der große Festzug durch die Stadt, der sich in drei Abteilungen gliedert.
Die dem Zuge zu Grunde liegenden Gedanken sind: „Die Fischerei“, „Wallensteins Einzug“ und „Alt-Memmingen“. Die zweite Abteilung, die den historischen Teil darstellt, beteiligt sich an einem Festakt auf dem Marktplatze. Es erfolgt hiebei der Empfang Wallensteins und die Schlüsselübergabe durch den Rat der Stadt.
Nach dem Zuge, etwa gegen halb 4 Uhr, beginnt das Volksfest auf dem Festplatz. Der weit über die Grenzen der alten Reichsstadt Memmingen hinaus bekannte Fischertag mit seinen schönen, historischen und künstlerisch auf hoher Stufe stehenden Darbietungen wird sicher auch heuer wieder wie in früheren Jahren seine Wirkung nicht verfehlen und eine Menge froher und schaulustiger Gäste nach Memmingen locken. Sonderzüge sind eingelegt und werden durch Anschlag an den Bahnhöfen bekannt gegeben werden. Auf das in der heutigen Nummer erscheinende Inserat wird hingewiesen!
Dito:
Ottobeuren. Festzeichen zum Memminger Fischertag sind bei Gemeindediener Wölfle Ottobeuren zu haben, pro Stück 1 Mark. Dieselben müssen bis Donnerstag, den 20. ds., gelöst sein.
Ausgabe Nr. 186 vom 17. August, S. 8
Annoncen Fischertag (s. Screenshot)
Großer Fischertag 1925. Daasabgabe.
Zum Schmücken der Gebäude innerhalb der Stadt wird am Samstag, den 22. August, Daas abgegeben. Das Bündel (ausreichend für 5 Kränze oder 5 Meter Guirlanden) kostet 30 Pfennig. Ausweise, die zum Empfang von Daas berechtigen, werden am Donnerstag und Freitag, vormittags von 9 bis 12 Uhr und nachmittags von 3 bis 6 ½ Uhr im schwarzen Ochsen, hinteres Nebenzimmer, abgegeben.
Quartiere.
Wir benötigen für die Nacht vom 25. auf 26. August 60 bis 80 Privatbetten gegen Bezahlung. Anmeldungen zu gleicher Zeit wie oben erbeten.
Festzeichen, Festschriften u.s.w.
Ab Mittwoch werden die Festzeichen von Haus zu Haus und in den Geschäften von Hönes, Briechle, Klimmer, Eugen Müller und Schelle verkauft. Näheres im lokalen Teil.
Fischertagsverein.
--------------
Zum großen Fischertag empfehle
Fischbären
in verschiedenen Größen. 46414
Seilerei Karl Hail. Memmingen beim „Kreuz“, Inh.: Ed. Pfeifer.
Ausgabe Nr. 192, Montag, 24.08.1925, S. 4
Die Zugsordnung zu Wallensteins Einzug ist folgende:
3 Fanfarenbläser, 25 Mann Kroaten zu Pferd, 25 Mann Dragoner zu Pferd, Wallenstein mit 15 Generälen zu Pferd, 12 Pappenheimer in Ausrüstung zu Pferd, Hofhaltung, bestehend aus 6spänniger Stabswagen mit 6 Rappen, Sänfte Nr. 1, 6spänniger Stabswagen mit 6 Schimmeln, Sänfte Nr. 2, 10 Hofdamen zu Pferd; 14 Mann reitende Jäger zu Pferd, Artillerie mit 2 Geschützen, 4spännig, nebst 2 Pulverwagen, 2spännig; Fußvolk, 27 Mann Arkebussiere, 27 Mann Pikeniere, 28 Mann Musketiere, 16 Mann Armbrustschützen; es folgen die Bagage und der Troß, bestehend aus Kapuzinerwagen, Astronomenwagen, Marketenderwagen, Bagagewagen 1 u. 2, 6 Packpferde, 1 Panjewagen, der Hurenwaibel, Profoß, 4 Dragoner zu Pferd.
Alle Autos, die während der Aufstellung die Straßen passieren, werden umgeleitet. Außerdem ist der Autoverkehr von 12 bis 1 Uhr gesperrt.
Nr. 192 vom Montag, 24.08.1925, als „Festzeitung“: pdf 373 und 374 (eigentlich bis 377)
Nr. 194, 26.08.1925, S. 5 (pdf-S. 383) sind die Fischerkönige ab 1900 genannt:
Fischerkönige vergangener Jahre.
Bis jetzt wurden folgende Fischer mit dem Binsenhut gekrönt:
1900: Pferdemetzger Albrecht Diesel †,
1901: Maler Georg Schwarz †,
1902: Schneidermeister Sigmund Honacker,
1903: Ausgeher Jakob Dangel,
1904: Ausgeher Fritz Schieß,
1905: Schreinermeister Karl Fackler ,
1906: Gerbersfohn Anton Müller,
1907: Bäckermeister Barthol. Held †
1908: Gerbermeister Karl Schwarz †,
1909: Bäckermeister Hans Schlegel,
1910: Stat.-Geh.-Sohn J. Espenmüller,
1911: Webmeister Hans Ade,
1912: Fabrikarbeiterssohn Ignaz Duile,
1913 - 1919: Spenglergeh. Wilh. Bäßler,
1919: Elektriker Emil Bäßler,
1920 - 1924: Malerm. Th. Wassermann,
1924: Mechanikerssohn Karl Bäßler.
Nr. 195, Donnerstag, 27.08.1925, S. 4 (pdf 390; ganzseitiger Bericht)
Des großen Fischertages zweiter Teil.
Ungefähr 20,000 Besucher. — Das Wetter hält sich. — Fabelhafter Eindruck und Riesenbegeisterung beim Festzuge. — Das Volksfest auf der Grimmelschanz.
Das Festspiel.
wf. Am gestrigen Mittwoch Mittag ging der zweite Teil des großen Memminger Fischertages vom Stapel. Die Regenschauer des Vormittags hatten nachgelassen, nur hie und da kam ein zager Versuch vom Himmel, die Veranstaltung zu stören. Ungeheure Menschenmassen waren mit den Vormittags- und Mittagszügen gekommen und hatten pulsierendes Leben in die Stadt gebracht, sodaß die Geschäftsleute voll zu tun hatten, um dem Ansturme gerecht zu werden.
Bereits gegen halb 1 Uhr wurden Absperrmaßnahmen getroffen. Schupo, die Feuerwehr, die Schutzmannschaft und sonstige Hilfskräfte standen zur Verfügung und doch hätten sie bald alle nicht ausgereicht, die Massen, die da den Kordon immer wieder zu durchbrechen suchten, zurückzuhalten, um eine freie Entwicklung des Zuges zu ermöglichen. Die Ulmerstraße und der Marktplatz war das auserwählteste Ziel der Schaulustigen, wurde doch vor dem Ulmertore Wallensteins Zug zusammengestellt und war auf dem Marktplatz das große Festspiel mit Wallensteins Einzug und der Schlüsselübergabe zu erwarten. Für 2 Uhr war der Festzug angesagt; die Geduld der Zuschauer wurde aber auf eine gar harte Probe gestellt, denn mit nicht weniger als 50 Minuten Verspätung kam Wallenstein mit seinem Riesengefolge angeritten. Vorher verkündete der Herold der freien Reichsstadt Memmingen (Hauptlehrer Jakob) mit weittragender Stimme der Bürgerschaft, daß Herzog Wallenstein in der Stadt Aufenthalt nehmen und daß die Bürgerschaft angewiesen werde, sich nicht auf den Straßen und den Fenstern zu zeigen, sondern geräuschlos, auf daß der bohe Herr in Nichts gestört werde, ihrer Beschäftigung nachzugehen habe. Weiters gab er bekannt, daß der Herzog in Graf Hans Fugger's Bau Wohnung nehmen werde.
Kurz darauf kamen 4 Fanfarenbläser und ein Obrist angeritten, dem der Herold der freien Reichsstadt den Gruß und die Ergebenheit der Stadt vermeldete und ihn bat, dies dem hohen Herrn mitzuteilen. Es folgten 25 Mann Kroaten, 25 Mann Dragoner zu Pferd und dann Wallenstein (Herr W. Göppel), in prächtigem, weißledernen Koller mit wallendem Federhut, begleitet von seinem Adjutanten.
Mittlerweile war der Rat der Stadt aus dem Rathause getreten (Museumsgebäude). In groß angelegter Rede begrüßte der Bürgermeister (Herr Wiedemann) den hohen Feldherrn, sprach von den Nöten und Drangsalen der Stadt, die sie nun schon während vieler Jahre erleiden mußte und drückte die Bitte aus, daß die Bewohner nach Möglichkeit von Tribut und Frohn verschont blieben.
(Anm. der Schriftleitung: Die Presseplätze waren ohne Verschulden der Leitung in die äußerste Ecke des Steuerhauses gedrängt worden, sodaß man nur Teile des Textes verstand: dies ist umso bedauerlicher, als dadurch auch fremde Pressevertreter in Mitleidenschaft gezogen wurden). Wallenstein dankte für den Empfang, sicherte möglichste Schonung zu und übernahm dann die Schlüssel der Stadt. Hierauf trug die Gilde der Memminger Meistersänger ein Begrüßungslied vor.
Es darf und muß hier bemerkt werden, daß dieses Festspiel freie Dichtung ist, denn der Einzug Wallensteins gestaltete sich wesentlich anders. Der Chronist der Stadt Memmingen, Unold, schreibt darüber in seiner Geschichte der Stadt Memmingen:
Der Einzug Wallensteins war zum Niedergassentor herein. (Es stand zwischen dem von Wachterschen Hause und dem Bürger- und Engelbräu). Den Anfang machten morgens früh den 30. Mai (1630) 30 Reisewagen, jeder mit 6 Pferden bespannt, und dann dauerte es fort mit Fahren und Reiten bis gegen Mittag. Hierauf,um 3 Uhr kam der Herzog selbst mit seinen Fürsten, Grafen, Freiherrrn und Hauptleuten und einem langen Nachzug von Reise- und Bagagewagen, Kutschen und Reitpferden, sodaß an diesem Tage bei 700 Pferde in die Stadt kamen. Der Herzog fuhr herein in einer mit 6 Schimmeln bespannten Kutsche und durch die stillen Straßen hindurch. – Kein Bürger zeigte sich außer den Häusern – in Graf Hans Fuggers Bau, wo er seine Wohnung nahm.
Dies war der wirkliche Hergang, der natürlich zu einem Festspiel keineswegs Stoff und Farbe liefern kann, sondern entsprechend umgearbeitet und verschönt werden mußte. So entstand die obige Darstellung.
Die Sprache des Festspiels ist mittelalterlich gehalten und läßt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Auch sind vorhergegangene und nachfolgende Geschehnisse in die Reden des Herolds, des Bürgermeisters und Wallensteins eingeflochten, um das Festspiel dramatisch zu gestalten. Die Wirkung war denn auch überwältigend. Abgesehen von der Tatsache, daß das Festspiel wegen mangelnden Raumes nur einigen Hunderten verständlich und zugänglich war (die hinter den ersten Reihen Stehenden langweilten sich, verließen sogar ihre Plätze und gingen spazieren), ergab die Aufstellung der Reiterei, der Generäle Wallensteins, des Hofstaates mit seinen Kutschen und Sänften ein malerisches Bild des Marktplatzes, das denn auch weidlich photographische- und Filmzwecke ausgenützt wurde.
Weiter ging Wallensteins Zug. Seine Generäle folgten in Prunkgewändern, hoch zu Roß. 12 Pappenheimer in blinkender Stahlrüstung, ebenfalls zu Pferd, dann die Hofhaltung, bestehend aus zwei sechsspännigen Stabswagen, besetzt mit den Damen der Fürstlichkeiten. Dazwischen sah man eine von zwei kleinen Pferden getragene und von Pagen gehaltene Sänfte. Die Stabswagen waren in rot-gold und blau-gold gehalten, auf den Lakaienplätzen standen je zwei Pagen, unbeweglich wie Marmorbilder. Wer dies farbenfrohe Bild gesehen, wird es nicht mehr aus dem Gedächtnis bringen. Aber noch war Wallensteins Zug nicht zu Ende. Auf edlen Pferden ritten 10 Hofdamen, folgten 14 reitende Jäger, Artillerie mit zwei schweren Geschützen je mit 4 Pferden bespannt nebst zwei Pulverwagen. Fußvolk, 27 Mann Arkebusiere, 27 Mann Pickeniere, 28 Mann Musketiere, 16 Mann Armbrustschützen folgten, alle in echter, historischer Tracht, bunt zusammengewürfelt, ein Farbenspiel von entzückender Wirkung. Den Schluß bildete die Bagage und der Troß, bestehend aus Kapuzinerwagen, Astronomenwagen, Marketenderwagen, zwei Bagagewagen, 6 Packpferden, Panjewagen, Hurenwaibel, Profoß und vier Dragoner zu Pferd.
Die ungeheure Wirkung all dieser Pracht allein vermochte hintanzuhalten, daß nicht alles, was zuschaute, in hellen begeisterten Jubel ausbrach, in einen Jubel, der nicht nur dem Gesehenen, sondern auch den Veranstaltern und nicht zuletzt der Vaterstadt gelten sollte. Gerade unsere heutige Zeit ist farben- und geschichtshungrig, glaubt man doch in allem Früheren die gute, alte Zeit wiederzufinden, die die rauhe Gegenwart so sehr vermißt. Und doch muß es auch damals nicht so golden gewesen sein, hören wir doch von harten Kriegsnöten, von Drangsal und Frohn, von Schinderei und Knechtung. Aber über die Vergangenheit breitet sich der mildtätige Schleier des Vergessens, und nur noch das Schöne, Hehre und Heilige bleibt in wacher Erinnerung. Möge es auch in Zukunft so bleiben.
Wallensteins Zug vereinigte sich nach dem Festspiel mit den andern zwei Zügen zum
großen Festzug.
lk. Wer zu Beginn des Festzuges noch in eine andere Gegend der Stadt kommen wollte, konnte nur mit rücksichtsloser Anwendung aller Kraft die dichten Reihen längs der Straßen durchkreuzen. Tausende und aber Tausende umsäumten in drangvoller Enge die Bürgersteige. Beim Zug jedoch – und das muß anerkannt werden – konnte man im Großen und Ganzen gute Disziplin des Publikums beobachten. Die Straßenmitte wurde immer bereitwilligst geräumt und dann auch freigehalten.
Alle Fenster der die Straßen begrenzenden Häuser waren dicht besetzt, selbst aus Speicherlucken und von Dächern aus sahen viele Hunderte dem prachtvollen Schauspiel, das sich da unten vollzog, zu. Zum Glück dauerte der Festakt auf dem Marktplatz nicht allzulange, sodaß man nur selten ungeduldige Stimmen hörte. Auf dem Weinmarkt harrte eine Riesenmenge auf das Erscheinen des Zuges, wo wohl die beste Gelegenheit war, ihn sicher zu sehen, erschien er dort doch zweimal und mußte einmal sogar den Platz zu einer Wendung benützen.
Ein Drängen, wenn auch ein kurzes entstand, als die vier Fanfarenbläser hoch zu Roß erschienen im weißledernen Koller. Unmittelbar schlossen sich an sie drei alte Germanen zu Pferd, ohne Sattel, in ihren Büffelfellen mit den charakteristischen Stierhörnern auf dem Eisenhelm. Sie eröffneten den Zug der Festwagen.
Unmittelbar an sie schloß sich in logischer Reihenfolge das
Barthelopfer,
eine Verehrung des altdeutschen obersten Gottes Wodan an. Vier Ochsen ziehen den Wagen, aus dem die Opferstätte errichtet ist. Drei Priesterinnen in langen wallenden Opferkleidern stehen am Altar und bringen ihre Opfer dar: eine Garbe als Opfer der Mutter Erde, Baumfrüchte als Opfer des hl. Haines, einen Fisch als Opfer des Wassers. Zwei kräftige Germanenrecken halten Wache am hl. Stein gegen eventuelles Eindringen Unbefugter, während hinter dem Altar als Abschreckung die greuliche Trud hockt. Große und kleine Germanen führen hinter dem Wagen die Opfertiere mit, die noch von einigen wehrhaften Männern bewacht werden gegen räuberische Überfälle. Daran an schloß sich die
Fischerkapelle
an der Spitze einer Reihe von Fischerknaben und -Mädchen mit den ihnen zukommenden Emblemen, die alle zusammen wiederum nur den Vortrupp des
Fischerkönigswagen
bildeten. Hoch oben thront der heurige F ischerkönig, Herr Starz, in seiner Amtstracht, neben bezw. unter ihm die drei preisgekrönten Fischer, umgeben von Dienern und Dienerinnen; seinem Prunkwagen folgt ein Teil der Fischer, mit denen er am Vormittag noch um die Krone gerungen hat Auch die
Sieben Schwaben
hatten sich zum Fest eingestellt, nur waren sie nicht mit der langen Lanze, sondern mit einem Riesenfischbären gekommen und hatten, ganz im Memminger Geist, den „Mau“ im Stadtbach herausgefischt, wie es so einmal passiert sein soll. Bunt gekleidet trugen sie an ihrem schweren Bären gar schwer.
Nicht nur Politik und Wirtschaft waren von jeher in Memmingens Mauern hoch gepflegt, auch Kunst und Wissenschaft verstanden die Alt-Memminger wohl zu pflegen. Eine Gruppe aus jenen Zeiten hatte sich auch gestern eingefunden und das war die
Gilde der Memminger Meistersinger.
Ihnen voran schritt das Symbol der Musik, die Lyra, umgeben von Kindern in historischer Tracht. Die Meistersinger selbst folgten in zwangslosem Zug in ihren bunten wallenden Umhängen.
Dann führte der Zug weiteres aus Memmingens Geschichte vor, aber nicht mehr althistorisches Memminger Alltagsleben, sondern eine Begebenheit aus dem Jahre 1630:
Wallensteins Einzug,
den wir an anderer Stelle bereits detaillierten. An ihn schloß sich wiederum ein Stück Dauergeschichte Memmingens an: die
Knabenkapelle in historischer Tracht,
ihre flotten Weisen spielend unter Führung ihres Dirigenten, Herrn Schelle. Kinder waren es noch und darum war es nicht minder logisch, daß nun auch etwas anderes aus Memmingens Althergebrachtem folgte: das
Kinderfest.
Die Mädelchen alle in der damaligen schmucken Tracht mit den langen Röcken und dem Gebetbuch in der Hand, eine Tracht, die von unserer jetzigen Damenwelt zwar als „unverständlich und unpraktisch“ aber doch als „lieb“ bezeichnet wurde. Ihnen folgten die Buben mit den weißen Strümpfen, den dunklen Hosen und fliegenden Röcken und der weißen Perücke. Diese Gruppe war wohl mit vom Schönsten und die Kinder waren ganz und gar bei der Sache. Den Kindern voran schritten zuerst die drei Könige und natürlich ist ebenmäßiger Harmonie drei Königinnen ist besonders prachtvollem Ornat, bei den Kinderfesten früherer Zeiten die drei besten in der Schule, durch diese Hervorstellung deshalb auch besonders ausgezeichnet. An die Kinder schloß sich noch die Maienkönigin des Kinderfestes 1925 an, in langem, silberglitzerndem Kleid, mit Kranz und Schleppe, die von einem Pagen getragen wurde. Himmelblau gekleidete Mädchen mit Birkenzweigen geleiteten sie zu beiden Seiten im Zug. Daran schloß sich wiederum eine Alt-Meminger Sitte:
Das Brunnenschmücken,
eine Handlung, die innig mit dem Fischertag im Zusammenhang steht. Auf dem Wagen dieser Gruppe war ein alter Pumpbrunnen aufgestellt, den die Jungfern der alten Reichsstadt Memmingen alljährlich, so auch gestern schmückten und mit allerlei Eßbarem behängten, das dann die Schutzmänner zum Dank für ihre nicht allzu angenehme Arbeit sich holten. –
Was dann kam, hat vielen vielleicht am besten gefallen, wenngleich man schlecht sagen kann, was das Beste am Festzug war: der Ausflug der
Biedermeierfamilie.
Papa und Mama schritten steif und doch wieder graziös voran, die Kinder folgten hinter ihnen und das Kleinste wurde vom Schwesterl im Biedermeierwägerl nachgezogen, ängstlich behütet von den Geschwistern. Während nun diese Gruppe Historisches überhaupt darstellte, kam unmittelbar darauf wieder spezifisch Meinmingisches:
Der Hopfenwagen.
In Hopfenranken gehüllt sitzen Männlein und Weiblein um die Metzen, zupfen die goldgelben Dolden und vertreiben sich die Zeit mit allerlei Allotria und Singen von alten Zupfianer-Liedern.
Eines fehlte noch, ohne das „Memmingen“ gar nicht Memmingen wäre und was Memmingen weit über seinen Burgfrieden hinaus bekannt gemacht hat:
Der Mau.
So kommt er denn, man wäre fast versucht, zu sagen „In Lebensgröße“. Auf einem Wagen steht er, wohl an die drei Meter im Durchmesser und blinzelt auf die Zuschauer herunter. Leider ist ihm gegen Schluß des Zuges der rechte Augendeckel und der linke Mundwinkel runtergefallen. Daß er auf Reinlichkeit hält, hat er bewiesen, hat er sich doch mehrere Male die Nase putzen lassen. Man scheint es aber allzu gründlich besorgt zu haben. Es wird ihm aber nichts machen, denn er hat heute Nacht, als man sich endlich doch hat trennen müssen, recht freundlich runtergelacht auf alle die, die ihm gestern und auch sonst schon gar oft zum heimlichen Lächeln verleitet haben, –
Der Fischertagsfestzug wäre aber nicht vollständig gewesen, wenn nicht auch jene auf den Plan getreten wären, die die Arbeit nach dem Fest haben:
Die Schmotzmänner.
Aber sie kamen beileibe nicht in ihren Schmoßkitteln, nein, fein aufgeputzt marschierten sie am Schlusse des Zuges. Die „Krücke“, das Instrument, das ihnen bei ihrer Arbeit dient, geschultert. Gar oft aber finden sie beim Ausräumen des Baches noch prachtvolle Forellen, die sich in „ihrem“ Element, dem Schmotz, verschlupft haben, es soll sogar vorgekommen sein, daß sie die größte aller gefangenen Forellen hatten, aber eben, weil sie nicht zu der Zunft der Fischer gehörten und weil sie zu spät daran waren, niemals Fischerkönig werden konnten. Daß sie oft die schönsten Fische noch fangen, zeigten sie, indem acht Mann von ihnen eine prachtvolle Riesenforelle auf Stangen mittrugen.
Damit war der Festzug beendigt, griff doch die letzte Gruppe eigentlich schon auf die nachfolgenden Tage über. Memmingen hat mit diesem Festzug gezeigt, was es zu leisten vermag, wenn ein einheitlicher Wille vorhanden ist. Bei allen Zuschauern konnte man hohe Befriedigung über das Gebotene feststellen und manche verstiegen sich zu der Behauptung, daß auch der letzte große Festzug in München nicht schöner war, wenigstens seien die Figuren Memmingens klarer gewesen, insoferne es keines Rätselratens bedurfte, um den Sinn des Gebotenen zu verstehen. Die Aufmachung sei mindestens ebenso schön gewesen. Allgemein also hat der Zug gefallen und das mag seinen Veranstaltern allein schon Dank dafür sein.
Nach Beendigung des riesenhaften Festzuges gings hinaus zum
Volksfest auf der Grimmelschanz
wf. Zwar mußte man gute Schuhe anhaben, dem fußtiefen Dreck um den Eingang herum ausweichen zu können, aber wie man sah, konnten dies auch Damen mit ganz ausgeschnitten Schuhen. Das Riesenzelt, in dem gleich zwei Musikkapellen spielten, war überfüllt und so blieb den Festbesuchern nichts anderes übrig, als sich im Freien niederzulassen. Der Wettergott blinzelte sogar mit einem Sonnenauge, aber es war zu schwach, um aufzuleuchten. Allenthalben bewegtestes Leben. Hier das „Lager Wallensteins“, in dem sich das Heer aufhielt und bei Bier und Wein, Armbrustschießen und sonstigen Vergnügungen sich die Zeit vertrieb. Dort die Forellen in Glasbehältern, wartend auf die glücklichen Gewinner. Zahlreich aufgestellte Buden sorgten für alle Bedürfnisse, sodaß man sich (…)
Ausgabe Nr. 196 vom 28.08.1925, S. 3
[Ankündigung]
Wiederholung des Fischertagsfestzuges.
Wie aus heutiger Anzeige zu ersehen ist, wird der Einzug Wallensteins (2. Teil) am kommenden Sonntag, mittags 1 Uhr. wiederholt werden. Dieser Entschluß des Fischertagsvereins ist nicht freudig genug zu begrüßen, hat doch der Festzog riesenhafte Begeisterung und allseitige Anerkennung, auch von den Großstädtern, gefunden. Nochmals wird sich ein reiches, buntes, farbenprächtiges Bild auftun, wird sich ein Stück Geschichte vor dem Beschauer entrollen, das unverwischbare Eindrücke hinterlassen wird. Die Riesenzahl von Zuschauern, wie sie der Festtag brachte, wird am Sonntag kaum erreicht werden, sodaß man mit größerer Muße das bunte Spiel betrachten kann.
Eilt alle von Nah und Fern, die ihr das großartige Schauspiel noch nicht gesehen, herbei. Ihr werdet alle befriedigt nach Hause kehren. Und diejenigen, die den Festzug bereits gesehen, die werden ihn wieder und wieder betrachten und werden begeistert sein von Prunk und Pracht.
Die Losung für den kommenden Sonntag heißt: Auf nach Memmingen zum Fischertagsfestzug!
Ausgabe Nr. 197, Samstag, 29.08.1925, S. 4
Memmingen. Zur Wiederholung des Fischertags-Festzuges.
Für das Festspiel am Marktplatz werden morgen, Sonntag, abgesonderte Räume geschaffen, in welche der Zutritt nur gegen Lösung eines neuen Festzeichens (1 Reichsmark) gestattet ist.
Nach Beendigung des Festaktes am Marktplatz marschieren Knabenkapelle, Kinderfestgruppe und Wallensteingruppe ab und nehmen folgenden Weg: Kalchstraße - Bahnhofstraße - Maximilianstraße - Waldhornstraße - Schwesterstraße - Theaterplatz - Kramerstraße - Baumstraße - Lindauerstraße - Kreuzstraße - Kramerstraße - Maximilianstraße - Salzstraße - Kalchstraße - Kramerstraße -
Weinmarkt (Süd) - Rohmarkt - Herrenstraße - Westertorstraße.
Vergangenen Mittwoch hatte sich eine übergroße Zahl Schaulustiger an den großen Plätzen und Hauptstraßen postiert, während die Nebenstraßen verhältnismäßig wenig Zuschauer aufwiesen; es wird daher empfohlen, auch die Nebenstraßen für die Aufstellung zu benützen. Nicht unerwähnt soll bleiben, daß weder eine Kürzung des Festspiels, noch der beiden Gruppen stattfinden wird.
Ausgabe Nr. 198, 31.08.1925, S. 5
Die Wiederholung des historischen Festzuges.
lk. Memmingen, 31. Aug.
Auf allgemeinen Wunsch hatte sich der Fischertagsverein bereitgefunden, den historischen Teil des Fischertagsfestzuges, d. h. den Einzug Wallensteins, am gestrigen Sonntag zu wiederholen. Daß es nicht umsonst war, hat der Besuch gezeigt, der auch gestern wieder Tausende zusammengeführt hatte. Waren auch keine Extrazüge eingelegt, so hatten unsere wackeren Eisenbahner doch auch gestern wieder, wie schon am eigentlichen Fischerfesttag, alle Hände voll zu tun, um den Massenverkehr zu bewältigen. Daß alles glatt und reibungslos abging, zeigt wieder einmal klar, auf welch hoher Stufe das deutsche Verkehrswesen steht, zeigt aber ganz besonders auch den Geist, der in unseren Verkehrsbeamten, hier besonders in unseren Memminger Verkehrsbeamten, steckt. Sie haben sich zweifellos um das Gelingen des Haupt- wie des Nachfestes ein großes Verdienst um ihre Vaterstadt erworben. Auch die verschiedenen Zufahrtsstraßen wiesen starken Verkehr auf. Daß es hier nicht immer reibungslos abging, war vielleicht nicht zuletzt auch der etwas großen Nervosität verschiedener Verkehrsordner zuzuschreiben. So war z. B. nicht recht verständlich, warum die die Ulmerstraße hereinkommenden Radfahrer kurz vor dem Festzug, wo die Ulmerstraße vom Schiffgarten an abgesperrt war, nicht mehr den Kuhberg hinabfahren sollten, der doch mit dem Fesizug absolut nichts zu tun hatte.
Die Straßen der Stadt, besonders die Ulmer Straße, durch die wiederum der Einzug Wallensteins erfolgte, waren dicht umsäumt von Zuschauern. Mit etwas mehr Pünktlichkeit als am Hauptfesttag kam denn auch der Zug herein. Auch das Kinderfest war diesmal von hier aus bereits zu sehen. An der Spitze deselben zog wieder die historische Knabenkapelle ein und hinter den Kindern die immer wieder gern gesehene Biedermeierfamilie. Das war leider alles, was außer dem Einzug Wallensteins noch am Festzug mitmachte. Auf der Marktplatz fand wiederum die Schlüsselübergabe statt, wobei nicht nur der Platz, soweit er nicht abgesperrt war, sondern auch die Zungangsstraßen voll Zuschauer waren. Von hier aus zog der Zug den bekanntgegebenen Weg und endete auf dem Festplatze an der Grimmelschanze.
Heller Sonnenschein lachte nunmehr, wie wohl es den Vormittag ab und zu zu regnen begonnen hatte. Was war natürlicher, als daß sich dementsprechend auf dem Festplatz gar bald Kopf an Kopf drängte! Im Nu waren die drei Zelte wieder dicht besetzt, geradezu an eine gefüllte Heringsbüchse erinnernd. Im abgesperrten Raum hatten sich die Wallensteiner niedergelassen und nun schloß sich ein wildromantisches Lagerleben an. Zelte wurden aufgeschlagen, bald flammten Lagerfeuer auf, über denen mächtige Fleischstücke am Spieß gebraten wurden. Der Bierkrug kreiste. Die Memminger Meistersinger gaben Proben ihres Könnens, die Kroaten zeigten sich nicht als milde Landsknechte, sondern als Künstler auf dem Gebiete Terpsichorens, führten alte Landknechtstänze auf, die sich großen Beifalls erfreuen konnten. Vor allem aber war es ein prachtvolles, farbenprächtiges Bild, das sich hier im Glanze der Sonne abspielte. Natürliche Grazie, Lust und Liebe zur Sache wirkten hier zusammen zu dem vollen Gelingen.
Allmählich senkten sich die Schatten der Nacht über das Treiben, doch gaben sie der Sache eine andere, aber nicht minder schöne Note: die drei bis vier Lagerfeuer sandten ihr rotes Licht über den Platz und gaben ihm eine magische Beleuchtung. Funken sprühten in mächtige Höhen auf, durch die immer wieder nachgeschürten Tannenäste wirksam angefacht. Leuchtkugeln erhellten das Dunkel.
Leider ließen sich die Zivilisten nicht bis zur Schluß außerhalb des Lagers halten. Mit dem Moment des Eindringens war der ganze Effekt verdorben. Beim Einbruch der Dunkelheit bekam man auch eine Ahnung von der Beschießung einer Stadt: Böller wurden an verschiedenen Plätzen gelöst, die teilweise mit sehr gemischten Gefühlen aufgenommen wurden. So hat einer einen Nervenschock erlitten, sodaß ihn die Sanitätskolonne ins Krankenhaus bringen mußte. Überhaupt hat die Sanitätskolonne gar manches geleistet. In 15 Fällen wurde ihre Hilfe in Anspruch genommen, drei Transporte mußte sie während der beiden Festtage ausführen, davon zwei nach dem Krankenhaus und einen nach der Wohnung.
Während dessen konzertierte in den Zelten fleißig die Stadtkapelle und sorgte dafür, daß die Stimmung, die schon einmal durch das Fest als solches, dann auch durch den freien Tag und weiter durch das Wetter vorhanden war, nicht verflog. Richtiger Kellerbetrieb herrschte bis weit in die Nacht hinein noch, als Berichterstatter dieses längst mit einem Fluch auf den ganzen Fischertag die Decke über den Kopf gezogen hatte, um den Grimmelschanzenlärm abzudämpfen.
So war auch die Wiederholung des Festes ein durchschlagender Erfolg, der unserem Fischertagsverein mit seinem Vorsitzenden, Herrn Kleiber, und dem Organisator des Wallenstein-Einzuges, Herrn Göppel, voll und ganz zu gönnen ist. Alle, die ihre Zeit und Kraft, nicht zuletzt ihren Geldbeutel, in den Dienst des Heimatfestes gestellt haben, sei auch an dieser Stelle der Dank aller Teilnehmer ausgedrückt.
______________________________________
Abschriften, Zusammenstellung und Foto: Helmut Scharpf, 08/2025
Laut der damals aktuellen Volkszählung wohnten in Memmingen 14.111 Personen, 14% mehr als noch 1910. Auch die Zahl der Haushalte – 1910 waren es 2.994, 1925 dann mit 3.626 sogar 21% mehr – war deutlich gestiegen. Die Bedeutung des Fischertags kann man insofern auch an der Zahl der Besucher ermessen, denn es kamen mit 20.000 mehr als Memmingen damals Einwohner hatte! Der Vollständigkeit halber hier die Zusammensetzung der Memminger Bevölkerung nach Konfessionen: 6.595 waren evangelisch-lutherisch, 24 sonstige Protestanten, 7.166 waren römisch-katholisch, 195 Israeliten und 131 Sonstige.
Im Zusammenhang mit Wallensteins Einzug in Memmingen zeigt das Foto – im wahrsten Sinne des Wortes – eine „Schlüsselszene“, denn Wallenstein (hier gespielt von W. Göppel) lässt sich vor der Großzunft vom Bürgermeister symbolisch den Schlüssel der Stadt übergeben. An den Gebäuden dazwischen lässt sich ablesen: Schuhhaus Josef Kraus bzw. Schnellsohlerei von Josef Kraus / Uhrengeschäft Maria Mühleisen. Das Ottobeurer Tagblatt (gleichzeitig Memminger Volksblatt und Schwäbischer Generalanzeiger Babenhausen) berichtete sehr ausführlich, am 24.08.1925 verwandelte sich die Zeitung sogar in eine mehrseitige Fischertags-Festzeitung.
Nachfolgend sei hier die Abschrift einiger Artikel wiedergegeben, vom 03.07. bis 31.08.1925:
Ottobeurer Tagblatt, 03.07.1925, S. 3:
Großer Fischertag.
Der Festplatz an der Grimmelschanz gesichert.
Die Werbeplakate von Willi Schropp sind eingetroffen.
Zum großen Fischertag in Memmingen am 25 /26. August wird seitens der Ausschüsse vorbildlich gearbeitet, um das Fest zu einem wirklichen Volksfest zu machen. Gestern tagte im „Waldhorn“ der „Presse- und Werbungsausschuß“, in dem vor allem bekanntgegeben wurde, daß der Festplatz an der Grimmelschanze nunmehr durch großes Entgegenkommen der Frau von Wachter und des Pächters Hrn. Huber zum „Strauß“ gesichert ist. Die ganze, sogenannte Grimmelschanz, die sich vom Burgsaal bis zum Bürger- und Engelbräu westlich an die Stadtmauer anlehnt, ist Festplatz.
Hier, auf dem 3 Tagwerk großen Platz unter dem Schutze des 1445 erbauten, mit seinen Schwalbenschwanzzinnen trotzig in die Welt schauenden Mehlsackturmes findet auch die Krönung des Fischerkönigs mit altem Drum und dran statt.
Der Bierausschank erfolgt in zwei großen Bierzelten, die vom Bürger- und Engelbräu und von der Schiffbrauerei erstellt werden. Außerdem sind auf dem Festplatz 3 Wurstbuden, 2 Bäckerbuden, 2 Konditorbuden, 2 Buden für Rauchwaren und Liköre, eine Weinbude, 2 Limonadenbuden und eine Käsebude. Der Fischertagsverein wird die hiesigen Geschäftsleute in nächster Zeit zur Beteiligung einladen.
Als Militärmusik
wurde die vollzählige, 33 Mann starke Kapelle des 5. Pionier-Bataillons Ulm unter der Leitung des Obermusikmeisters Wolter verpflichtet. (…)
Nr. 185, Freitag, 14.08.1925, S. 9
Vom Fischertag. Seit dem Kriege soll heuer zum ersten Male wieder der Memminger Fischertag in seiner alten Pracht und Größe gefeiert werden. Die Festlichkeiten erstrecken sich über den 25. und 26. August. Am 25. August, dem Vorabend des eigentlichen Festes, findet abends 8 Uhr in den Zelten auf dem Festplatz der Begrüßungsabend mit Vorführungen statt.
Am 26. August früh halb 8 Uhr ziehen die kostümierten Fischer in die Stadt, um 8 Uhr beginnt das Ausfischen des Stadtbaches, woran sich um 10 Uhr der Frühschoppen auf dem Festplatz anschließt. Während desselben erfolgt die Krönung des Fischerkönigs und die altherkömmliche Auslosung der Forellen. Nachmittags um 2 Uhr beginnt der große Festzug durch die Stadt, der sich in drei Abteilungen gliedert.
Die dem Zuge zu Grunde liegenden Gedanken sind: „Die Fischerei“, „Wallensteins Einzug“ und „Alt-Memmingen“. Die zweite Abteilung, die den historischen Teil darstellt, beteiligt sich an einem Festakt auf dem Marktplatze. Es erfolgt hiebei der Empfang Wallensteins und die Schlüsselübergabe durch den Rat der Stadt.
Nach dem Zuge, etwa gegen halb 4 Uhr, beginnt das Volksfest auf dem Festplatz. Der weit über die Grenzen der alten Reichsstadt Memmingen hinaus bekannte Fischertag mit seinen schönen, historischen und künstlerisch auf hoher Stufe stehenden Darbietungen wird sicher auch heuer wieder wie in früheren Jahren seine Wirkung nicht verfehlen und eine Menge froher und schaulustiger Gäste nach Memmingen locken. Sonderzüge sind eingelegt und werden durch Anschlag an den Bahnhöfen bekannt gegeben werden. Auf das in der heutigen Nummer erscheinende Inserat wird hingewiesen!
Dito:
Ottobeuren. Festzeichen zum Memminger Fischertag sind bei Gemeindediener Wölfle Ottobeuren zu haben, pro Stück 1 Mark. Dieselben müssen bis Donnerstag, den 20. ds., gelöst sein.
Ausgabe Nr. 186 vom 17. August, S. 8
Annoncen Fischertag (s. Screenshot)
Großer Fischertag 1925. Daasabgabe.
Zum Schmücken der Gebäude innerhalb der Stadt wird am Samstag, den 22. August, Daas abgegeben. Das Bündel (ausreichend für 5 Kränze oder 5 Meter Guirlanden) kostet 30 Pfennig. Ausweise, die zum Empfang von Daas berechtigen, werden am Donnerstag und Freitag, vormittags von 9 bis 12 Uhr und nachmittags von 3 bis 6 ½ Uhr im schwarzen Ochsen, hinteres Nebenzimmer, abgegeben.
Quartiere.
Wir benötigen für die Nacht vom 25. auf 26. August 60 bis 80 Privatbetten gegen Bezahlung. Anmeldungen zu gleicher Zeit wie oben erbeten.
Festzeichen, Festschriften u.s.w.
Ab Mittwoch werden die Festzeichen von Haus zu Haus und in den Geschäften von Hönes, Briechle, Klimmer, Eugen Müller und Schelle verkauft. Näheres im lokalen Teil.
Fischertagsverein.
--------------
Zum großen Fischertag empfehle
Fischbären
in verschiedenen Größen. 46414
Seilerei Karl Hail. Memmingen beim „Kreuz“, Inh.: Ed. Pfeifer.
Ausgabe Nr. 192, Montag, 24.08.1925, S. 4
Die Zugsordnung zu Wallensteins Einzug ist folgende:
3 Fanfarenbläser, 25 Mann Kroaten zu Pferd, 25 Mann Dragoner zu Pferd, Wallenstein mit 15 Generälen zu Pferd, 12 Pappenheimer in Ausrüstung zu Pferd, Hofhaltung, bestehend aus 6spänniger Stabswagen mit 6 Rappen, Sänfte Nr. 1, 6spänniger Stabswagen mit 6 Schimmeln, Sänfte Nr. 2, 10 Hofdamen zu Pferd; 14 Mann reitende Jäger zu Pferd, Artillerie mit 2 Geschützen, 4spännig, nebst 2 Pulverwagen, 2spännig; Fußvolk, 27 Mann Arkebussiere, 27 Mann Pikeniere, 28 Mann Musketiere, 16 Mann Armbrustschützen; es folgen die Bagage und der Troß, bestehend aus Kapuzinerwagen, Astronomenwagen, Marketenderwagen, Bagagewagen 1 u. 2, 6 Packpferde, 1 Panjewagen, der Hurenwaibel, Profoß, 4 Dragoner zu Pferd.
Alle Autos, die während der Aufstellung die Straßen passieren, werden umgeleitet. Außerdem ist der Autoverkehr von 12 bis 1 Uhr gesperrt.
Nr. 192 vom Montag, 24.08.1925, als „Festzeitung“: pdf 373 und 374 (eigentlich bis 377)
Nr. 194, 26.08.1925, S. 5 (pdf-S. 383) sind die Fischerkönige ab 1900 genannt:
Fischerkönige vergangener Jahre.
Bis jetzt wurden folgende Fischer mit dem Binsenhut gekrönt:
1900: Pferdemetzger Albrecht Diesel †,
1901: Maler Georg Schwarz †,
1902: Schneidermeister Sigmund Honacker,
1903: Ausgeher Jakob Dangel,
1904: Ausgeher Fritz Schieß,
1905: Schreinermeister Karl Fackler ,
1906: Gerbersfohn Anton Müller,
1907: Bäckermeister Barthol. Held †
1908: Gerbermeister Karl Schwarz †,
1909: Bäckermeister Hans Schlegel,
1910: Stat.-Geh.-Sohn J. Espenmüller,
1911: Webmeister Hans Ade,
1912: Fabrikarbeiterssohn Ignaz Duile,
1913 - 1919: Spenglergeh. Wilh. Bäßler,
1919: Elektriker Emil Bäßler,
1920 - 1924: Malerm. Th. Wassermann,
1924: Mechanikerssohn Karl Bäßler.
Nr. 195, Donnerstag, 27.08.1925, S. 4 (pdf 390; ganzseitiger Bericht)
Des großen Fischertages zweiter Teil.
Ungefähr 20,000 Besucher. — Das Wetter hält sich. — Fabelhafter Eindruck und Riesenbegeisterung beim Festzuge. — Das Volksfest auf der Grimmelschanz.
Das Festspiel.
wf. Am gestrigen Mittwoch Mittag ging der zweite Teil des großen Memminger Fischertages vom Stapel. Die Regenschauer des Vormittags hatten nachgelassen, nur hie und da kam ein zager Versuch vom Himmel, die Veranstaltung zu stören. Ungeheure Menschenmassen waren mit den Vormittags- und Mittagszügen gekommen und hatten pulsierendes Leben in die Stadt gebracht, sodaß die Geschäftsleute voll zu tun hatten, um dem Ansturme gerecht zu werden.
Bereits gegen halb 1 Uhr wurden Absperrmaßnahmen getroffen. Schupo, die Feuerwehr, die Schutzmannschaft und sonstige Hilfskräfte standen zur Verfügung und doch hätten sie bald alle nicht ausgereicht, die Massen, die da den Kordon immer wieder zu durchbrechen suchten, zurückzuhalten, um eine freie Entwicklung des Zuges zu ermöglichen. Die Ulmerstraße und der Marktplatz war das auserwählteste Ziel der Schaulustigen, wurde doch vor dem Ulmertore Wallensteins Zug zusammengestellt und war auf dem Marktplatz das große Festspiel mit Wallensteins Einzug und der Schlüsselübergabe zu erwarten. Für 2 Uhr war der Festzug angesagt; die Geduld der Zuschauer wurde aber auf eine gar harte Probe gestellt, denn mit nicht weniger als 50 Minuten Verspätung kam Wallenstein mit seinem Riesengefolge angeritten. Vorher verkündete der Herold der freien Reichsstadt Memmingen (Hauptlehrer Jakob) mit weittragender Stimme der Bürgerschaft, daß Herzog Wallenstein in der Stadt Aufenthalt nehmen und daß die Bürgerschaft angewiesen werde, sich nicht auf den Straßen und den Fenstern zu zeigen, sondern geräuschlos, auf daß der bohe Herr in Nichts gestört werde, ihrer Beschäftigung nachzugehen habe. Weiters gab er bekannt, daß der Herzog in Graf Hans Fugger's Bau Wohnung nehmen werde.
Kurz darauf kamen 4 Fanfarenbläser und ein Obrist angeritten, dem der Herold der freien Reichsstadt den Gruß und die Ergebenheit der Stadt vermeldete und ihn bat, dies dem hohen Herrn mitzuteilen. Es folgten 25 Mann Kroaten, 25 Mann Dragoner zu Pferd und dann Wallenstein (Herr W. Göppel), in prächtigem, weißledernen Koller mit wallendem Federhut, begleitet von seinem Adjutanten.
Mittlerweile war der Rat der Stadt aus dem Rathause getreten (Museumsgebäude). In groß angelegter Rede begrüßte der Bürgermeister (Herr Wiedemann) den hohen Feldherrn, sprach von den Nöten und Drangsalen der Stadt, die sie nun schon während vieler Jahre erleiden mußte und drückte die Bitte aus, daß die Bewohner nach Möglichkeit von Tribut und Frohn verschont blieben.
(Anm. der Schriftleitung: Die Presseplätze waren ohne Verschulden der Leitung in die äußerste Ecke des Steuerhauses gedrängt worden, sodaß man nur Teile des Textes verstand: dies ist umso bedauerlicher, als dadurch auch fremde Pressevertreter in Mitleidenschaft gezogen wurden). Wallenstein dankte für den Empfang, sicherte möglichste Schonung zu und übernahm dann die Schlüssel der Stadt. Hierauf trug die Gilde der Memminger Meistersänger ein Begrüßungslied vor.
Es darf und muß hier bemerkt werden, daß dieses Festspiel freie Dichtung ist, denn der Einzug Wallensteins gestaltete sich wesentlich anders. Der Chronist der Stadt Memmingen, Unold, schreibt darüber in seiner Geschichte der Stadt Memmingen:
Der Einzug Wallensteins war zum Niedergassentor herein. (Es stand zwischen dem von Wachterschen Hause und dem Bürger- und Engelbräu). Den Anfang machten morgens früh den 30. Mai (1630) 30 Reisewagen, jeder mit 6 Pferden bespannt, und dann dauerte es fort mit Fahren und Reiten bis gegen Mittag. Hierauf,um 3 Uhr kam der Herzog selbst mit seinen Fürsten, Grafen, Freiherrrn und Hauptleuten und einem langen Nachzug von Reise- und Bagagewagen, Kutschen und Reitpferden, sodaß an diesem Tage bei 700 Pferde in die Stadt kamen. Der Herzog fuhr herein in einer mit 6 Schimmeln bespannten Kutsche und durch die stillen Straßen hindurch. – Kein Bürger zeigte sich außer den Häusern – in Graf Hans Fuggers Bau, wo er seine Wohnung nahm.
Dies war der wirkliche Hergang, der natürlich zu einem Festspiel keineswegs Stoff und Farbe liefern kann, sondern entsprechend umgearbeitet und verschönt werden mußte. So entstand die obige Darstellung.
Die Sprache des Festspiels ist mittelalterlich gehalten und läßt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Auch sind vorhergegangene und nachfolgende Geschehnisse in die Reden des Herolds, des Bürgermeisters und Wallensteins eingeflochten, um das Festspiel dramatisch zu gestalten. Die Wirkung war denn auch überwältigend. Abgesehen von der Tatsache, daß das Festspiel wegen mangelnden Raumes nur einigen Hunderten verständlich und zugänglich war (die hinter den ersten Reihen Stehenden langweilten sich, verließen sogar ihre Plätze und gingen spazieren), ergab die Aufstellung der Reiterei, der Generäle Wallensteins, des Hofstaates mit seinen Kutschen und Sänften ein malerisches Bild des Marktplatzes, das denn auch weidlich photographische- und Filmzwecke ausgenützt wurde.
Weiter ging Wallensteins Zug. Seine Generäle folgten in Prunkgewändern, hoch zu Roß. 12 Pappenheimer in blinkender Stahlrüstung, ebenfalls zu Pferd, dann die Hofhaltung, bestehend aus zwei sechsspännigen Stabswagen, besetzt mit den Damen der Fürstlichkeiten. Dazwischen sah man eine von zwei kleinen Pferden getragene und von Pagen gehaltene Sänfte. Die Stabswagen waren in rot-gold und blau-gold gehalten, auf den Lakaienplätzen standen je zwei Pagen, unbeweglich wie Marmorbilder. Wer dies farbenfrohe Bild gesehen, wird es nicht mehr aus dem Gedächtnis bringen. Aber noch war Wallensteins Zug nicht zu Ende. Auf edlen Pferden ritten 10 Hofdamen, folgten 14 reitende Jäger, Artillerie mit zwei schweren Geschützen je mit 4 Pferden bespannt nebst zwei Pulverwagen. Fußvolk, 27 Mann Arkebusiere, 27 Mann Pickeniere, 28 Mann Musketiere, 16 Mann Armbrustschützen folgten, alle in echter, historischer Tracht, bunt zusammengewürfelt, ein Farbenspiel von entzückender Wirkung. Den Schluß bildete die Bagage und der Troß, bestehend aus Kapuzinerwagen, Astronomenwagen, Marketenderwagen, zwei Bagagewagen, 6 Packpferden, Panjewagen, Hurenwaibel, Profoß und vier Dragoner zu Pferd.
Die ungeheure Wirkung all dieser Pracht allein vermochte hintanzuhalten, daß nicht alles, was zuschaute, in hellen begeisterten Jubel ausbrach, in einen Jubel, der nicht nur dem Gesehenen, sondern auch den Veranstaltern und nicht zuletzt der Vaterstadt gelten sollte. Gerade unsere heutige Zeit ist farben- und geschichtshungrig, glaubt man doch in allem Früheren die gute, alte Zeit wiederzufinden, die die rauhe Gegenwart so sehr vermißt. Und doch muß es auch damals nicht so golden gewesen sein, hören wir doch von harten Kriegsnöten, von Drangsal und Frohn, von Schinderei und Knechtung. Aber über die Vergangenheit breitet sich der mildtätige Schleier des Vergessens, und nur noch das Schöne, Hehre und Heilige bleibt in wacher Erinnerung. Möge es auch in Zukunft so bleiben.
Wallensteins Zug vereinigte sich nach dem Festspiel mit den andern zwei Zügen zum
großen Festzug.
lk. Wer zu Beginn des Festzuges noch in eine andere Gegend der Stadt kommen wollte, konnte nur mit rücksichtsloser Anwendung aller Kraft die dichten Reihen längs der Straßen durchkreuzen. Tausende und aber Tausende umsäumten in drangvoller Enge die Bürgersteige. Beim Zug jedoch – und das muß anerkannt werden – konnte man im Großen und Ganzen gute Disziplin des Publikums beobachten. Die Straßenmitte wurde immer bereitwilligst geräumt und dann auch freigehalten.
Alle Fenster der die Straßen begrenzenden Häuser waren dicht besetzt, selbst aus Speicherlucken und von Dächern aus sahen viele Hunderte dem prachtvollen Schauspiel, das sich da unten vollzog, zu. Zum Glück dauerte der Festakt auf dem Marktplatz nicht allzulange, sodaß man nur selten ungeduldige Stimmen hörte. Auf dem Weinmarkt harrte eine Riesenmenge auf das Erscheinen des Zuges, wo wohl die beste Gelegenheit war, ihn sicher zu sehen, erschien er dort doch zweimal und mußte einmal sogar den Platz zu einer Wendung benützen.
Ein Drängen, wenn auch ein kurzes entstand, als die vier Fanfarenbläser hoch zu Roß erschienen im weißledernen Koller. Unmittelbar schlossen sich an sie drei alte Germanen zu Pferd, ohne Sattel, in ihren Büffelfellen mit den charakteristischen Stierhörnern auf dem Eisenhelm. Sie eröffneten den Zug der Festwagen.
Unmittelbar an sie schloß sich in logischer Reihenfolge das
Barthelopfer,
eine Verehrung des altdeutschen obersten Gottes Wodan an. Vier Ochsen ziehen den Wagen, aus dem die Opferstätte errichtet ist. Drei Priesterinnen in langen wallenden Opferkleidern stehen am Altar und bringen ihre Opfer dar: eine Garbe als Opfer der Mutter Erde, Baumfrüchte als Opfer des hl. Haines, einen Fisch als Opfer des Wassers. Zwei kräftige Germanenrecken halten Wache am hl. Stein gegen eventuelles Eindringen Unbefugter, während hinter dem Altar als Abschreckung die greuliche Trud hockt. Große und kleine Germanen führen hinter dem Wagen die Opfertiere mit, die noch von einigen wehrhaften Männern bewacht werden gegen räuberische Überfälle. Daran an schloß sich die
Fischerkapelle
an der Spitze einer Reihe von Fischerknaben und -Mädchen mit den ihnen zukommenden Emblemen, die alle zusammen wiederum nur den Vortrupp des
Fischerkönigswagen
bildeten. Hoch oben thront der heurige F ischerkönig, Herr Starz, in seiner Amtstracht, neben bezw. unter ihm die drei preisgekrönten Fischer, umgeben von Dienern und Dienerinnen; seinem Prunkwagen folgt ein Teil der Fischer, mit denen er am Vormittag noch um die Krone gerungen hat Auch die
Sieben Schwaben
hatten sich zum Fest eingestellt, nur waren sie nicht mit der langen Lanze, sondern mit einem Riesenfischbären gekommen und hatten, ganz im Memminger Geist, den „Mau“ im Stadtbach herausgefischt, wie es so einmal passiert sein soll. Bunt gekleidet trugen sie an ihrem schweren Bären gar schwer.
Nicht nur Politik und Wirtschaft waren von jeher in Memmingens Mauern hoch gepflegt, auch Kunst und Wissenschaft verstanden die Alt-Memminger wohl zu pflegen. Eine Gruppe aus jenen Zeiten hatte sich auch gestern eingefunden und das war die
Gilde der Memminger Meistersinger.
Ihnen voran schritt das Symbol der Musik, die Lyra, umgeben von Kindern in historischer Tracht. Die Meistersinger selbst folgten in zwangslosem Zug in ihren bunten wallenden Umhängen.
Dann führte der Zug weiteres aus Memmingens Geschichte vor, aber nicht mehr althistorisches Memminger Alltagsleben, sondern eine Begebenheit aus dem Jahre 1630:
Wallensteins Einzug,
den wir an anderer Stelle bereits detaillierten. An ihn schloß sich wiederum ein Stück Dauergeschichte Memmingens an: die
Knabenkapelle in historischer Tracht,
ihre flotten Weisen spielend unter Führung ihres Dirigenten, Herrn Schelle. Kinder waren es noch und darum war es nicht minder logisch, daß nun auch etwas anderes aus Memmingens Althergebrachtem folgte: das
Kinderfest.
Die Mädelchen alle in der damaligen schmucken Tracht mit den langen Röcken und dem Gebetbuch in der Hand, eine Tracht, die von unserer jetzigen Damenwelt zwar als „unverständlich und unpraktisch“ aber doch als „lieb“ bezeichnet wurde. Ihnen folgten die Buben mit den weißen Strümpfen, den dunklen Hosen und fliegenden Röcken und der weißen Perücke. Diese Gruppe war wohl mit vom Schönsten und die Kinder waren ganz und gar bei der Sache. Den Kindern voran schritten zuerst die drei Könige und natürlich ist ebenmäßiger Harmonie drei Königinnen ist besonders prachtvollem Ornat, bei den Kinderfesten früherer Zeiten die drei besten in der Schule, durch diese Hervorstellung deshalb auch besonders ausgezeichnet. An die Kinder schloß sich noch die Maienkönigin des Kinderfestes 1925 an, in langem, silberglitzerndem Kleid, mit Kranz und Schleppe, die von einem Pagen getragen wurde. Himmelblau gekleidete Mädchen mit Birkenzweigen geleiteten sie zu beiden Seiten im Zug. Daran schloß sich wiederum eine Alt-Meminger Sitte:
Das Brunnenschmücken,
eine Handlung, die innig mit dem Fischertag im Zusammenhang steht. Auf dem Wagen dieser Gruppe war ein alter Pumpbrunnen aufgestellt, den die Jungfern der alten Reichsstadt Memmingen alljährlich, so auch gestern schmückten und mit allerlei Eßbarem behängten, das dann die Schutzmänner zum Dank für ihre nicht allzu angenehme Arbeit sich holten. –
Was dann kam, hat vielen vielleicht am besten gefallen, wenngleich man schlecht sagen kann, was das Beste am Festzug war: der Ausflug der
Biedermeierfamilie.
Papa und Mama schritten steif und doch wieder graziös voran, die Kinder folgten hinter ihnen und das Kleinste wurde vom Schwesterl im Biedermeierwägerl nachgezogen, ängstlich behütet von den Geschwistern. Während nun diese Gruppe Historisches überhaupt darstellte, kam unmittelbar darauf wieder spezifisch Meinmingisches:
Der Hopfenwagen.
In Hopfenranken gehüllt sitzen Männlein und Weiblein um die Metzen, zupfen die goldgelben Dolden und vertreiben sich die Zeit mit allerlei Allotria und Singen von alten Zupfianer-Liedern.
Eines fehlte noch, ohne das „Memmingen“ gar nicht Memmingen wäre und was Memmingen weit über seinen Burgfrieden hinaus bekannt gemacht hat:
Der Mau.
So kommt er denn, man wäre fast versucht, zu sagen „In Lebensgröße“. Auf einem Wagen steht er, wohl an die drei Meter im Durchmesser und blinzelt auf die Zuschauer herunter. Leider ist ihm gegen Schluß des Zuges der rechte Augendeckel und der linke Mundwinkel runtergefallen. Daß er auf Reinlichkeit hält, hat er bewiesen, hat er sich doch mehrere Male die Nase putzen lassen. Man scheint es aber allzu gründlich besorgt zu haben. Es wird ihm aber nichts machen, denn er hat heute Nacht, als man sich endlich doch hat trennen müssen, recht freundlich runtergelacht auf alle die, die ihm gestern und auch sonst schon gar oft zum heimlichen Lächeln verleitet haben, –
Der Fischertagsfestzug wäre aber nicht vollständig gewesen, wenn nicht auch jene auf den Plan getreten wären, die die Arbeit nach dem Fest haben:
Die Schmotzmänner.
Aber sie kamen beileibe nicht in ihren Schmoßkitteln, nein, fein aufgeputzt marschierten sie am Schlusse des Zuges. Die „Krücke“, das Instrument, das ihnen bei ihrer Arbeit dient, geschultert. Gar oft aber finden sie beim Ausräumen des Baches noch prachtvolle Forellen, die sich in „ihrem“ Element, dem Schmotz, verschlupft haben, es soll sogar vorgekommen sein, daß sie die größte aller gefangenen Forellen hatten, aber eben, weil sie nicht zu der Zunft der Fischer gehörten und weil sie zu spät daran waren, niemals Fischerkönig werden konnten. Daß sie oft die schönsten Fische noch fangen, zeigten sie, indem acht Mann von ihnen eine prachtvolle Riesenforelle auf Stangen mittrugen.
Damit war der Festzug beendigt, griff doch die letzte Gruppe eigentlich schon auf die nachfolgenden Tage über. Memmingen hat mit diesem Festzug gezeigt, was es zu leisten vermag, wenn ein einheitlicher Wille vorhanden ist. Bei allen Zuschauern konnte man hohe Befriedigung über das Gebotene feststellen und manche verstiegen sich zu der Behauptung, daß auch der letzte große Festzug in München nicht schöner war, wenigstens seien die Figuren Memmingens klarer gewesen, insoferne es keines Rätselratens bedurfte, um den Sinn des Gebotenen zu verstehen. Die Aufmachung sei mindestens ebenso schön gewesen. Allgemein also hat der Zug gefallen und das mag seinen Veranstaltern allein schon Dank dafür sein.
Nach Beendigung des riesenhaften Festzuges gings hinaus zum
Volksfest auf der Grimmelschanz
wf. Zwar mußte man gute Schuhe anhaben, dem fußtiefen Dreck um den Eingang herum ausweichen zu können, aber wie man sah, konnten dies auch Damen mit ganz ausgeschnitten Schuhen. Das Riesenzelt, in dem gleich zwei Musikkapellen spielten, war überfüllt und so blieb den Festbesuchern nichts anderes übrig, als sich im Freien niederzulassen. Der Wettergott blinzelte sogar mit einem Sonnenauge, aber es war zu schwach, um aufzuleuchten. Allenthalben bewegtestes Leben. Hier das „Lager Wallensteins“, in dem sich das Heer aufhielt und bei Bier und Wein, Armbrustschießen und sonstigen Vergnügungen sich die Zeit vertrieb. Dort die Forellen in Glasbehältern, wartend auf die glücklichen Gewinner. Zahlreich aufgestellte Buden sorgten für alle Bedürfnisse, sodaß man sich (…)
Ausgabe Nr. 196 vom 28.08.1925, S. 3
[Ankündigung]
Wiederholung des Fischertagsfestzuges.
Wie aus heutiger Anzeige zu ersehen ist, wird der Einzug Wallensteins (2. Teil) am kommenden Sonntag, mittags 1 Uhr. wiederholt werden. Dieser Entschluß des Fischertagsvereins ist nicht freudig genug zu begrüßen, hat doch der Festzog riesenhafte Begeisterung und allseitige Anerkennung, auch von den Großstädtern, gefunden. Nochmals wird sich ein reiches, buntes, farbenprächtiges Bild auftun, wird sich ein Stück Geschichte vor dem Beschauer entrollen, das unverwischbare Eindrücke hinterlassen wird. Die Riesenzahl von Zuschauern, wie sie der Festtag brachte, wird am Sonntag kaum erreicht werden, sodaß man mit größerer Muße das bunte Spiel betrachten kann.
Eilt alle von Nah und Fern, die ihr das großartige Schauspiel noch nicht gesehen, herbei. Ihr werdet alle befriedigt nach Hause kehren. Und diejenigen, die den Festzug bereits gesehen, die werden ihn wieder und wieder betrachten und werden begeistert sein von Prunk und Pracht.
Die Losung für den kommenden Sonntag heißt: Auf nach Memmingen zum Fischertagsfestzug!
Ausgabe Nr. 197, Samstag, 29.08.1925, S. 4
Memmingen. Zur Wiederholung des Fischertags-Festzuges.
Für das Festspiel am Marktplatz werden morgen, Sonntag, abgesonderte Räume geschaffen, in welche der Zutritt nur gegen Lösung eines neuen Festzeichens (1 Reichsmark) gestattet ist.
Nach Beendigung des Festaktes am Marktplatz marschieren Knabenkapelle, Kinderfestgruppe und Wallensteingruppe ab und nehmen folgenden Weg: Kalchstraße - Bahnhofstraße - Maximilianstraße - Waldhornstraße - Schwesterstraße - Theaterplatz - Kramerstraße - Baumstraße - Lindauerstraße - Kreuzstraße - Kramerstraße - Maximilianstraße - Salzstraße - Kalchstraße - Kramerstraße -
Weinmarkt (Süd) - Rohmarkt - Herrenstraße - Westertorstraße.
Vergangenen Mittwoch hatte sich eine übergroße Zahl Schaulustiger an den großen Plätzen und Hauptstraßen postiert, während die Nebenstraßen verhältnismäßig wenig Zuschauer aufwiesen; es wird daher empfohlen, auch die Nebenstraßen für die Aufstellung zu benützen. Nicht unerwähnt soll bleiben, daß weder eine Kürzung des Festspiels, noch der beiden Gruppen stattfinden wird.
Ausgabe Nr. 198, 31.08.1925, S. 5
Die Wiederholung des historischen Festzuges.
lk. Memmingen, 31. Aug.
Auf allgemeinen Wunsch hatte sich der Fischertagsverein bereitgefunden, den historischen Teil des Fischertagsfestzuges, d. h. den Einzug Wallensteins, am gestrigen Sonntag zu wiederholen. Daß es nicht umsonst war, hat der Besuch gezeigt, der auch gestern wieder Tausende zusammengeführt hatte. Waren auch keine Extrazüge eingelegt, so hatten unsere wackeren Eisenbahner doch auch gestern wieder, wie schon am eigentlichen Fischerfesttag, alle Hände voll zu tun, um den Massenverkehr zu bewältigen. Daß alles glatt und reibungslos abging, zeigt wieder einmal klar, auf welch hoher Stufe das deutsche Verkehrswesen steht, zeigt aber ganz besonders auch den Geist, der in unseren Verkehrsbeamten, hier besonders in unseren Memminger Verkehrsbeamten, steckt. Sie haben sich zweifellos um das Gelingen des Haupt- wie des Nachfestes ein großes Verdienst um ihre Vaterstadt erworben. Auch die verschiedenen Zufahrtsstraßen wiesen starken Verkehr auf. Daß es hier nicht immer reibungslos abging, war vielleicht nicht zuletzt auch der etwas großen Nervosität verschiedener Verkehrsordner zuzuschreiben. So war z. B. nicht recht verständlich, warum die die Ulmerstraße hereinkommenden Radfahrer kurz vor dem Festzug, wo die Ulmerstraße vom Schiffgarten an abgesperrt war, nicht mehr den Kuhberg hinabfahren sollten, der doch mit dem Fesizug absolut nichts zu tun hatte.
Die Straßen der Stadt, besonders die Ulmer Straße, durch die wiederum der Einzug Wallensteins erfolgte, waren dicht umsäumt von Zuschauern. Mit etwas mehr Pünktlichkeit als am Hauptfesttag kam denn auch der Zug herein. Auch das Kinderfest war diesmal von hier aus bereits zu sehen. An der Spitze deselben zog wieder die historische Knabenkapelle ein und hinter den Kindern die immer wieder gern gesehene Biedermeierfamilie. Das war leider alles, was außer dem Einzug Wallensteins noch am Festzug mitmachte. Auf der Marktplatz fand wiederum die Schlüsselübergabe statt, wobei nicht nur der Platz, soweit er nicht abgesperrt war, sondern auch die Zungangsstraßen voll Zuschauer waren. Von hier aus zog der Zug den bekanntgegebenen Weg und endete auf dem Festplatze an der Grimmelschanze.
Heller Sonnenschein lachte nunmehr, wie wohl es den Vormittag ab und zu zu regnen begonnen hatte. Was war natürlicher, als daß sich dementsprechend auf dem Festplatz gar bald Kopf an Kopf drängte! Im Nu waren die drei Zelte wieder dicht besetzt, geradezu an eine gefüllte Heringsbüchse erinnernd. Im abgesperrten Raum hatten sich die Wallensteiner niedergelassen und nun schloß sich ein wildromantisches Lagerleben an. Zelte wurden aufgeschlagen, bald flammten Lagerfeuer auf, über denen mächtige Fleischstücke am Spieß gebraten wurden. Der Bierkrug kreiste. Die Memminger Meistersinger gaben Proben ihres Könnens, die Kroaten zeigten sich nicht als milde Landsknechte, sondern als Künstler auf dem Gebiete Terpsichorens, führten alte Landknechtstänze auf, die sich großen Beifalls erfreuen konnten. Vor allem aber war es ein prachtvolles, farbenprächtiges Bild, das sich hier im Glanze der Sonne abspielte. Natürliche Grazie, Lust und Liebe zur Sache wirkten hier zusammen zu dem vollen Gelingen.
Allmählich senkten sich die Schatten der Nacht über das Treiben, doch gaben sie der Sache eine andere, aber nicht minder schöne Note: die drei bis vier Lagerfeuer sandten ihr rotes Licht über den Platz und gaben ihm eine magische Beleuchtung. Funken sprühten in mächtige Höhen auf, durch die immer wieder nachgeschürten Tannenäste wirksam angefacht. Leuchtkugeln erhellten das Dunkel.
Leider ließen sich die Zivilisten nicht bis zur Schluß außerhalb des Lagers halten. Mit dem Moment des Eindringens war der ganze Effekt verdorben. Beim Einbruch der Dunkelheit bekam man auch eine Ahnung von der Beschießung einer Stadt: Böller wurden an verschiedenen Plätzen gelöst, die teilweise mit sehr gemischten Gefühlen aufgenommen wurden. So hat einer einen Nervenschock erlitten, sodaß ihn die Sanitätskolonne ins Krankenhaus bringen mußte. Überhaupt hat die Sanitätskolonne gar manches geleistet. In 15 Fällen wurde ihre Hilfe in Anspruch genommen, drei Transporte mußte sie während der beiden Festtage ausführen, davon zwei nach dem Krankenhaus und einen nach der Wohnung.
Während dessen konzertierte in den Zelten fleißig die Stadtkapelle und sorgte dafür, daß die Stimmung, die schon einmal durch das Fest als solches, dann auch durch den freien Tag und weiter durch das Wetter vorhanden war, nicht verflog. Richtiger Kellerbetrieb herrschte bis weit in die Nacht hinein noch, als Berichterstatter dieses längst mit einem Fluch auf den ganzen Fischertag die Decke über den Kopf gezogen hatte, um den Grimmelschanzenlärm abzudämpfen.
So war auch die Wiederholung des Festes ein durchschlagender Erfolg, der unserem Fischertagsverein mit seinem Vorsitzenden, Herrn Kleiber, und dem Organisator des Wallenstein-Einzuges, Herrn Göppel, voll und ganz zu gönnen ist. Alle, die ihre Zeit und Kraft, nicht zuletzt ihren Geldbeutel, in den Dienst des Heimatfestes gestellt haben, sei auch an dieser Stelle der Dank aller Teilnehmer ausgedrückt.
______________________________________
Abschriften, Zusammenstellung und Foto: Helmut Scharpf, 08/2025
Urheber
Ev. Karl Müller
Quelle
Sammlung Helmut Scharpf
Verleger
Helmut Scharpf
Datum
1925-08-26
Rechte
gemeinfrei