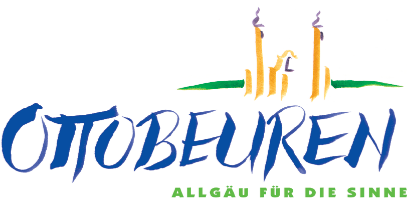08.04.1958 – Trauung im „Hochzeitsparadies Ottobeuren“
Titel
Beschreibung
Ein wunderbares Foto, das Ingrid und Martin Fischer auf dem Marktplatz Ottobeuren zeigt. Unmittelbar nach der standesamtlichen Trauung in Bad Wörishofen fuhren sie zur kirchlichen Trauung nach Ottobeuren; Zelebrant war Pater Maurus Zech. Der 8. April 1958 war ein Dienstag, ein aus heutiger Sicht eher ungewöhnlicher Tag. Damals war der Andrang jedoch derart groß, dass von den ersten Januartagen bis Ende Dezember in der Basilika geheiratet wurde. Teils wurden die Brautpaare – ohne vorheriges Wissen – zusammengefasst, auch an ganz normalen Werktagen fanden Trauungen statt. Die Hochzeiter kamen von weit her; nicht von Ungefähr sprach man im Zusammenhang mit Ottobeuren vom „Hochzeitsparadies“ – wie es ein Wagen beim Faschingsumzug in den 1950er Jahren thematisierte – oder gar von der „Hochzeitsfabrik“. In der Basilika Ottobeuren haben sich 1956 447 Paare trauen lassen – eine Rekordzahl, im Jahr 1958 waren es 403. (Zum Vergleich: In 2024 waren es lediglich neun Paare, im Sommerhalbjahr.)
Das Brautpaar kam in einem amerikanischen Nash, die kleine Gesellschaft fuhr mit einem VW-Bus von „Autoreisen Schindele“ (Bad Wörishofen) nach Ottobeuren. Der Bus war von einem Karosseriebauer aus Augsburg – Göppel – umgebaut worden (Firmengründung durch Markus Göppel in 1923; 2014 kam es zur Insovenz, die Firma Göppel wurde mangels Investoren aufgelöst.). Das Bonner Kennzeichen des Nash mag verwundern, war aber kein Zufall. Des Rätsels Lösung: Die Braut – Ingrid – kam aus dem Rheinland, sie wurde in Bonn geboren. Konditormeister Martin Fischer (*18.07.1927 in Bad Wörishofen, †16.12.1995 in Mindelheim) mauserte sich in Bad Wörishofen zur bekannten Persönlichkeit, saß viele Jahre für die CSU im Stadrat, Ingrid Fischer (geb. Abresch, *23.10.1935 in Bonn, †23.01.2024 in Mindelheim) war Fachverkäuferin und arbeitete vermutlich im „Café Fischer“.
Ingrid Fischer trug ein weißes Brautkleid, eine Modeerscheinung, die sich in den Wirtschaftswunderjahren immer mehr durchsetzte (s.u.). Das Foto war weder beschriftet noch datiert, konnte aber über den Eintrag im Trauungsbuch der Pfarrei auf den Tag genau bestimmt werden. Es hat sich angeboten, die Zahl der kirchlichen Trauungen in der Basilika gleich für mehrere Jahre unter die Lupe zu nehmen (lt. Unterlagen im Pfarrbüro):
1936 38 1937 44 1938 150 1939 133
1940 120 1941 115 1942 86 1943 128 1944 80 1945 80 1946 343 1947 238 1948 328 1949 346
1950 340 1951 370 1952 385 1953 421 1954 408 1955 440 1956 447 1957 382 1958 403 1959 387
1960 419 1961 361 1962 305 1963 280 1964 368 1965 334 1966 305 1967 284 1968 231 1969 212
1970 190 1971 175 1972 141 1973 124 1974 128 1975 103 1976 91 1977 93 1978 81 1979 79
1980 71 1981 65 1982 44 1983 44 1984 41 1985 38 1986 46 1987 37 1988 42 1989 42
1990 45 1991 40 1992 34 1993 23 1994 29 1995 20 1996 17 1997 18 1998 23 1999 32
2000 20 2001 12 2002 16 2003 8 2004 19 2005 18 2006 20 2007 23 2008 13 2009 14
2010 15 2011 18 2012 23 2013 9 2014 11 2015 19 2016 13 2017 15 2018 13 2019 13
2020 4 2021 16 2022 14 2023 12 2024 9 2025 10 (bis 4.10.2025)
Zum Vergleich nachfolgend die – erstaunlich konstanten – Zahlen der standesamtlichen Trauungen in Ottobeuren von 1936 bis heute (14.11.2025; Quelle: Ursula Zängerle, Bürgerbüro):
1936 35 1937 49 1938 36 1939 37
1940 39 1941 19 1942 19 1943 22 1944 30 1945 14 1946 46 1947 62 1948 74 1949 69
1950 49 1951 56 1952 40 1953 46 1954 46 1955 50 1956 50 1957 46 1958 53 1959 52
1960 57 1961 45 1962 50 1963 49 1964 55 1965 49 1966 55 1967 51 1968 30 1969 43
1970 43 1971 39 1972 39 1973 48 1974 50 1975 60 1976 45 1977 65 1978 54 1979 55
1980 50 1981 60 1982 58 1983 48 1984 46 1985 29 1986 56 1987 53 1988 42 1989 65
1990 67 1991 50 1992 75 1993 63 1994 49 1995 61 1996 62 1997 66 1998 45 1999 55
2000 49 2001 48 2002 40 2003 41 2004 52 2005 45 2006 35 2007 53 2008 37 2009 41
2010 32 2011 45 2012 49 2013 38 2014 39 2015 42 2016 51 2017 46 2018 48 2019 57
2020 45 2021 40 2022 58 2023 50 2024 35 2025 47
Die höchsten Zahlen finden sich in den Jahren 1948 (Währungsreform) und 1992, die niedrigsten Zahlen während des Zweiten Weltkriegs.
Einer Meldung des Statistischen Bundesamts vom 5.2.2026 zufolge sei die Zahl der Eheschließungen in Deutschland 2024 auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Statistik 1950 gefallen. In 2024 wurden bundesweit 349.200 Ehen geschlossen. Ende 2024 war knapp jede zweite erwachsene Person in Deutschland verheiratet, 30 Jahre zuvor waren es noch rund 60 Prozent der Erwachsenen.
Ende 2024 war knapp jede zweite erwachsene Person in Deutschland verheiratet, 30 Jahre zuvor waren es noch rund 60 Prozent der Erwachsenen. Bis zum ersten Ja-Wort dauert es immer länger, das Durchschnittsalter stieg innerhalb von 30 Jahren um rund sechs Jahre: 2024 waren Frauen bei ihrer ersten Heirat im Schnitt 32,9 Jahre alt, Männer 35,3 Jahre. Die Durchschnittsdauer einer Ehe bis zur Scheidung lag 2024 bei 14,7 Jahren und 1994 bei 12,0 Jahren.
Nicht alle Brautpaare waren so privilegiert wird die Fischers. Von einer ganz anderen Trauung der 1950er Jahre berichtete Eduard Schneider beim Advents-Nachmittag des Heimatdienstes Ottobeuren am 3.12.2025: Ein Knecht und eine Magd aus Heimertingen radelten nach Ottobeuren und ließen sich in der Basilika trauen. Danach gingen sie in den „Hirsch“, tranken ein Bier, aßen Schüblinge und radelten anschließend wieder zurück, um am selben Tag in der Landwirtschaft weiterzuarbeiten. Ihr Privileg: Da sie nun im Ehestand waren, baten sie ihren Herren, sich zukünftig ein Zimmer teilen zu dürfen.
Das Einzugsgebiet der Braupaare reichte weit über Ottobeuren hinaus, die Hochzeiter kamen auch aus weiter entfernten Orten. Eine detaillierte Analyse der Trauungsbücher bzw. Trauungsregister wäre lohnend. Spannend z.B. das Jahr 1945, in dem an einem Tag viele Paare mit slawischen Namen gleichzeitig geheiratet haben. In den Zahlen sind freilich keine Ottobeurer enthalten, die selbst an anderen Orten geheiratet haben, auch keine Protestanten bzw. Angehörige weiterer Konfessionen. Eine Anfrage nach der Zahl der standesamtlichen Trauungen ist bereits gestellt worden, um sie der Zahl der kirchlichen Trauungen gegenüberzustellen.
Quellen der katholischen Pfarreri St. Theodor und Alexander Ottobeuren:
Trauungs-Register (1936 - 45)
Trauungsregister (1946 - 48)
Trauungsregister (1948 - 50 inkl.)
Trauungs-Register (1951 - 1953)
Trauungsbuch 1954 - 1. September 1959
Trauungsbuch 1.9.1959 - 31.3.1964
Trauungsbuch 1.4.1964 - 31.5.1970
Trauungsbuch 1.6.1970 - 31.5.1971
Trauungs-Register 1.6.1971 - 4.12.1982
Trauungs-Register 1.1.1983 - 31.12.1998
Ehebuch 1999 -
In der Memminger Zeitung vom 02.01.1957 hieß es auf S. 4 („Allgäuer Heimat und Bayern-Chronik“) im Bericht zur Jahresabschlusspredigt (Überschrift: „Kardinal Wendel kritisiert Sittenverfall“):
„Der Kardinal wandte sich gegen ein zunehmendes Absinken des religiösen Lebens in der Oeffentlichkeit und eine drohende Auflösung des sittlichen Ordnungsgefühls. Von den etwa 8000 in den Jahren 1954/1955 von Katholiken in München eingegangenen Ehen seien nur 55 Prozent kirchlich geschlossen worden und die Zahl der konfessionell gemischten Ehen steige von Jahr zu Jahr.“
Wie sich das Verhältnis damals in Ottobeuren gestaltet, wird schon bald beantwortet werden können.
Zu den drei Fahrzeugen auf dem Foto schrieb Michael Scharpf eine Reihe von Einzelheiten zusammen:
Der Nash Ambassador war einfach zu bestimmen, da es die Blinker vorne und die Heckflossenstummelchen nur 1951 in dieser Form gab. Der VW „Kleinbus Sonderausführung“ ist 1951 vorgestellt worden. Für einen fetzigeren Namen sorgt sehr schnell der Kunde selbst, auch wenn die genaue Herleitung heute leider nicht mehr exakt nachvollziehbar ist. Samba könnte sich aus „Sonnendach-Ausführung mit besonderem Armaturenbrett“ oder auch „Sonder-Ausführung mit besonderer Ausstattung“ abgeleitet haben. Das Fahrzeug auf dem Foto ist allerdings keine Werksausführung, da die Form der Dachverglasung und der hinteren Seitenscheiben deutlich abweicht. Vermutlich hat Franz Schindele das bei einem Karosseriebauer so nach seinen Wünschen bestellt, sehr wahrscheinlich gleich 1950, als die ersten VW Busse auf den Markt kamen. Bereits Ende der 1920er Jahre ließ Schindele seine Busse mit großem Faltschiebedach und filigraner Rundumverglasung bei Kässbohrer in Ulm aufbauen. Der Wagen ganz im Hintergrund ist ein Goliath GP 700 mit Zweitaktmotor, hergestellt in Bremen bei Goliath, Teil des Borgward-Konzerns. Das schmucklose etwas gedrungene Erscheinungsbild weist auf ein frühes Modell ab 1950 hin.
Wie unterscheiden sich die Begriffe Hochzeit und Trauung?
Die Begriffe „Hochzeit“ und „Trauung“ werden im Alltag zwar oft synonym gebraucht, bezeichnen aber eigentlich verschiedene Aspekte desselben Ereignisses.
1. Die Trauung
Die Trauung ist der eigentliche Akt des Eheversprechens, also der Moment, in dem das Paar sich gegenseitig das Jawort gibt – vor einer zuständigen Instanz.
• Formen:
◦ Standesamtliche Trauung: die rechtlich verbindliche Eheschließung nach staatlichem Recht.
◦ Kirchliche Trauung: der religiöse Ritus, bei dem die Ehe gesegnet oder vor Gott geschlossen wird.
◦ (Es gibt auch freie Trauungen, die weder staatlich noch kirchlich, sondern symbolisch-feierlich sind.)
• Wortherkunft:
von trauen im Sinne von jemandem Vertrauen schenken, sich anvertrauen.
→ ursprünglich also: „sich einander anvertrauen“.
Kurz: Die Trauung ist der feierliche oder rechtliche Akt der Eheschließung.
2. Die Hochzeit
„Hochzeit“ bezeichnet ursprünglich den Festtag (oder die Festzeit) der Eheschließung. Heute meint man damit meist die gesamte Feier rund um die Eheschließung – inklusive Trauung, Empfang, Festessen, Tanz usw.
• Wortherkunft:
mittelhochdeutsch hochgezît = „hoher (also wichtiger, festlicher) Tag“.
→ bezeichnete ursprünglich jeden hohen Festtag, nicht nur die Eheschließung. Erst später wurde der Begriff auf das Heiratsfest spezialisiert.
Kurz: Die Hochzeit ist das Fest; die Trauung ist der rechtliche oder religiöse Akt.
______________________________________________
Die Trennung zwischen kirchlicher und staatlicher (standesamtlicher) Trauung ist ein Schlüsselereignis in der Rechts- und Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts in Deutschland. Vor 1875 war in Bayern / Deutscher Bund die kirchliche Trauung die staatlich anerkannte Form einer gültigen Eheschließung. 1876 wurde im Deutschen Reich die standesamtliche Trauung eingeführt, die kirchliche war nur noch religiös-symbolisch motiviert. (Personenstandsgesetzes von 1875, § 67–70 zur Eheschließung)
Für Deutschland allgemein und dem Königreich Bayern im Besonderen:
1. Hintergrund: Einheit von Kirche und Ehe im Alten Recht
Bis ins 19. Jahrhundert war die Eheschließung in Deutschland (bzw. den Einzelstaaten des Deutschen Bundes) im Wesentlichen eine kirchliche Angelegenheit.
• In katholischen Gebieten galt die Ehe als Sakrament, das nur durch eine kirchliche Trauung gültig war.
• In evangelischen Gebieten wurde sie zwar nicht als Sakrament, aber weiterhin als kirchlicher Vertrag vor Gott und Gemeinde verstanden.
• Der Staat erkannte diese kirchlich geschlossenen Ehen als rechtswirksam an.
Das heißt: Bis in die 1860er Jahre hinein war die kirchliche Trauung zugleich die staatlich gültige Eheschließung.
2. Einführung der staatlichen (zivilen) Ehe
Norddeutscher Bund (ab 1871: Deutsches Reich)
Die entscheidende Wende kam mit der Reichsgesetzgebung unter Bismarck während des sogenannten Kulturkampfs:
• Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Eheschließung
→ vom 6. Februar 1875, in Kraft 1. Januar 1876
(oft kurz: „Personenstandsgesetz von 1875“)
Dieses Gesetz führte ein:
• das Standesamt (als staatliche Behörde),
• die Zivilehe (die einzige rechtlich gültige Eheschließung),
• und machte die kirchliche Trauung rein religiös-symbolisch (ohne Rechtswirkung).
Damit galt: Nur die standesamtliche Trauung begründet eine rechtsgültige Ehe. Eine kirchliche Trauung durfte erst nach der standesamtlichen erfolgen.
3. Situation im Königreich Bayern
Bayern war bis 1871 ein eigenständiges Königreich mit eigenen Gesetzen. Hier verlief die Entwicklung leicht versetzt und mit gewissen Vorbehalten:
• Bayern war ein überwiegend katholisches Land und stand der preußischen Politik Bismarcks (insbesondere dem Kulturkampf) skeptisch gegenüber.
• Trotzdem musste Bayern als Teil des Deutschen Reichs (ab 1. Januar 1871) das Reichsrecht übernehmen, soweit es in seine Zuständigkeit fiel.
Daher:
• Auch in Bayern wurde die zivile Eheschließung 1875/76 eingeführt, also gleichzeitig mit dem Reichsgesetz.
• Vorher (bis 1875) war dort die kirchliche Trauung die rechtsverbindliche Form.
→ Der Wendepunkt war also das Reichspersonenstandsgesetz von 1875, in Kraft 1. Januar 1876 — auch im Königreich Bayern.
4. Kulturelle und kirchliche Reaktionen
• Die katholische Kirche lehnte die „Zivilehe“ zunächst ab und sprach von einer „Ehe ohne Segen Gottes“.
• Viele Katholiken ließen sich weiterhin kirchlich trauen, auch wenn die standesamtliche Trauung rechtlich vorgeschrieben war (teilweise mit Konflikten).
• In evangelischen Regionen war die Akzeptanz meist höher, da man die Ehe schon zuvor als „weltlich Ding“ (nach Luther) verstand.
Erst im 20. Jahrhundert (nach dem Ende des Kulturkampfs) entspannte sich das Verhältnis.
_____________________________________________________
Abschließend ein paar Worte zum Thema Braut-Mode:
Eine erste Trendsetterin war Queen Victoria, die 1840 in einem weißen Kleid heiratete — das machte Weiß in gehobenen Modekreisen populär. Für die Allgemeienheit blieben weiße Kleider aber teuer, auch im Erhalt, in ihrer nur einmalige Nutzung und blieben so gesehen eher ein Prestigesymbol.
In vielen Regionen trug die Mehrheit der Bräute deshalb einfach ihre beste Alltags- oder Festgarderobe; Farben wie dunkelblau, grau – und in manchen Gegenden auch schwarz – oder regionale Trachten waren üblich. Weiß blieb vor allem in wohlhabenderen Schichten verbreitet.
Im Wirtschaftswunderland der späten 1950er Jahren wuchs der Wohlstand (für viele Familien), Textilproduktion und Konfektion verbesserten sich — weiße, durch Spitze und Tüll verzierte Kleider wurden erschwinglicher. Die Hochzeitswirtschaft (Fotografen, Brautmodengeschäfte, Hochzeitskleider-Verleih) professionalisierte sich.
Dazu kam der Einfluss der Medien: Hollywood-Filme, Schlagertexte („Ganz in Weiß“ von Schlagersänger Roy Black, 1966 in Deutschland erfolgreichster Titel des Jahres) Promihochzeiten und Modezeitschriften zeigten idealisierte, weiße Hochzeitskleider — ein starkes Vorbild, das den Wunsch nach „klassischer“ Brauterscheinung verstärkte. Eine besondere Ikone: Grace Kellys hatte mit ihrer medial stark begleiteten Hochzeit 1956 großen Einfluss auf Brautmode.
Kirchliche / Symbolische Bedeutungen:
Weiß wurde (und wird) oft mit Reinheit, Unschuld und Neubeginn assoziiert — Bedeutungen, die gut zum Ritualcharakter der kirchlichen Trauung passen. In konservativeren kirchlichen Kreisen wurde die Braut traditionell als „Braut Christi“-Symbol gedeutet, was die Popularität weißer Gewänder begünstigte.
Die 1950er-Silhouetten (engen Taillen, volle Röcke, viele Stofflagen, Spitze, Schleier) eigneten sich besonders gut für weiße Stoffe — das sah „feierlich“ aus und passte zur Erwartung an die kirchliche Zeremonie und Hochzeitsfotos.
In Summe lässt sich damit erklären, warum sich nach dem Zweiten Weltkrieg weiße Brautkleider bei kirchlichen Trauungen stark verbreiteten.
__________________________________________
Scan des Hochzeitsfotos: Michael Scharpf, Nachbearbeitung, Recherche, Zusammenstellung: Helmut Scharpf, 11/2025